Blickschichten – Zur Methode der Anthroposophie
1 Emmaus
Im griechischen Wort Methode steckt ‹hodos›, der Weg zu etwas hin, und ‹meta›, das über, hinter oder in etwas Liegende. Oft ist im Weg, den man geht, ein anderer verborgen. Oder neben einem her verläuft die ganze Zeit ein zweiter, bis die beiden sich vereinen. Oder dieser ‹Zweite› ist ein ebenfalls Gehender: Hat man selbst sein Ziel erreicht, bemerkt man erst, dass man sich an jenem orientiert hatte, der einen heimlich begleitet und vielleicht auch indirekt geführt hatte, ja dass man dieser andere in einem höheren Bewusstsein selbst war.
Wird man dessen gewahr, dass zwei in einem leben und in einer chaotischen Erdenwirklichkeit ein Geistiges Sinn und Ordnung stiftet, wacht man gewissermaßen auf, nachdem man zuvor zwar Ziele angesteuert und Erlebtes reflektiert, aber letztlich unschuldig geschlummert hat. Und man wird das Bewusstsein dieses Weges, dieses Zweiten nicht mehr verlieren. Es wird zur Methode, sich selbst zu beobachten und zu begleiten. Man wird den intimen Dialog immer wieder suchen, im Gespräch sein mit dem eigenen Leben. Es vergeht nicht und man entgeht sich nie. Vielmehr begeht man das Sein wie ein Fest. Dabei ereignet sich manchmal die Gnade der Kommunion, das aufscheinende Bild einer Stimmigkeit der Biografie, das einen fortan leitet.
Aber zwischen Schlaf und Erwachen gibt es noch den Traum: das diffuse Reich der Ahnung, wo Idee und Wirklichkeit noch miteinander ringen. Wege können sich gliedern, zu Irrwegen werden, die niemals enden. Lebenswegzeichen können täuschen und vertauscht sein. Im Traum gehen Dinge ineinander über, an Albträumen kann man zugrunde gehen. Es ist das Labyrinth der Seele, der Anima oder Psyche, wo es uns zwischen Jauchzen und Betrübnis, Leidenschaft und Sich-Erheben hin und her wirft.
Den beiden Jüngern, die im Evangelium im solcherart bewegten Gespräch über das auf Golgatha Geschehene nach Emmaus unterwegs sind (Lk. 24, 13-33), gesellt sich ein Dritter bei, der ihr Reden bald zuhörend teilt, bald interessiert fragend belebt. Als sie einkehren, laden sie ihn ein zu bleiben, «denn es will Abend werden», und erkennen ihn beim Brechen des Brotes und Segnen des Weines als den Auferstandenen. Brannte nicht schon unser Herz, fragen sie sich rückblickend, als er mit uns sprach?
Solange Schmerzen und Ideale uns wachhalten, ist der innere Weg frei zu einer geistigen Welt, die den Menschen prüft und schützt – und kennt von Anfang an.
Aber zwischen Schlaf und Erwachen gibt es noch den Traum: das diffuse Reich der Ahnung, wo Idee und Wirklichkeit noch miteinander ringen.
2 Das Dorf
«Es war spät abends, als K ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee.» (Franz Kafka, ‹Das Schloss›)
Das Winzerdorf, wo ich, wenige Stunden auf der Welt, am schneereichen Faschingssonntagmorgen 1969 als Nachzügler ankam – meine Eltern waren schon alt –, lag in einem idyllischen Seitental des mittleren Rheins, an dessen Pforte eine Burgruine thronte. Später liebte ich es, von oben den Strom zu erblicken, er verhieß Weite, Leben, Kontakt. Doch sobald man wieder unten im Dorf war, war die Welt wie verschwunden, als habe sich eine Dornenhecke geschlossen. Im Winter erreichte die Sonne die Talsohle nicht, viele setzten hier freiwillig ihrem Dasein ein Ende. Unser Elternhaus, das jahrzehntelang die großväterliche Bäckerei beherbergt hatte, befand sich im Ortskern, direkt neben der erhöhten Kirche, die mir stumm ins Fenster blickte.
Einmal ging ich, schon Student, an einem Herbstabend vom Rhein ins Dorf hinauf. Die Straße verlief neben einem Bach und Waldhängen. Ich hörte nur meine Schritte und dann neben mir im Dunkel ein lautes Rascheln, das, als ich verunsichert schneller ging, zu einem nicht einzuordnenden Keuchen und Röhren wurde. Das Tier – meine erste Assoziation – setzte sich parallel zu meinem nun noch rascheren Laufen bedrohlich in Bewegung, als fühlte es sich von mir bedroht. Aber immer blieben die Büsche zwischen uns, bis Autoscheinwerfer den Spuk beendeten und ich im Ort mit pochendem Herzen anhielt. Ein Freund brachte Jahre später die Möglichkeit auf, dass es kaum ein Wildschwein, sondern etwas in mir gewesen war, das mich auf dem Weg überkommen hatte. Kurz vorher war damals mein Vater gestorben, auf jener Straße. Am Steuer seines Wagens war sein unerlöstes Herz stehen geblieben. Der Verstorbene suchte mich zu der Zeit in vielen Träumen auf. – Erst staunte ich über den Gedanken, und doch blieb er haften: dass mich meine Sinne getäuscht und sich das Szenario einzig im Inneren abgespielt haben könnte. Es blieb ein Grenzbereich, da war ein Weg oder etwas auf meinem Weg, das neben mir herlief, etwas Unheimliches, vielleicht ‹Böses›, jedenfalls etwas, das mich wach hielt. Bis dahin war mein Denken, Fühlen und Wollen, metaphorisch gesprochen, stets in die engen Grenzen jenes Tals heimgekehrt. Unmittelbar nach dem Tod meines Vaters lernte ich, vom Leben nach Berlin gerufen, als Praktikant in einem Waldorfkindergarten Steiners Werk und eine neue Welt kennen.
3 Klippen
Während viele seiner negativen Prophetien sich heute im Äußeren positiv erfüllen, mag sich der individuelle Weg Franz Kafkas im Stillen fortgesetzt haben. Die ‹Lebzeiten› seiner Werke schienen ihm selbst Totgeburten, auferstehend nur im lesenden Ich, das sich schöpferisch einbezieht. Kafkas Angst und selbst gewählte Isolation tritt uns heute als normativ Vernünftiges entgegen, insofern wir uns als Gefahren begreifen und voreinander gewarnt sein sollen. Der Briefschreiber Kafka hatte die Verlobte bloß vor den Raumforderungen seines Schreibens gewarnt, als taktisch-psychologische Maßnahme. Kafka hielt die Welt habituell auf Abstand, ein scheuer Meister der sozialen Distanzierung, jener Ersatzhandlungen einer Ellbogengesellschaft, für die er nicht geschaffen war. Im digitalen Medium ist heute das Passwort der Zugang zur Lebenswelt, die Selbstvermittlung im Profilbild unsere äußere Lebensform, während Kafkas Kosmos als handgeschriebener Stream einen künstlichen Textkörper schuf, da der faktische Leib ihn bedrohte. Schreiben war für Kafka normal, die Texte waren es nicht. Heute ist die Welt unnormal und ihre Gestalt zwar absurd, aber logisch begründet, so wie man auch dem intelligenten Erzähler Kafka mit dem ersten Satz abkauft, dass ein Mensch als Ungeziefer aufwacht, wird es bloß als folgerichtige Realitätsumdeutung suggeriert. Auch der 1921/22 entstandene (und abgebrochene) ‹Schloss›-Roman war eine Projektion der Intimität, Zeugnis der Verwirrung des Individuums darüber, was es darf und soll und wer es ist. Die prominente Rezeptionsgeschichte – Kafka habe den staatlichen Totalitarismus vorweggenommen – ist eine interpretatorische Autobahn, aber kein Pfad zum Kern des Werkes. Dass es uns auch etwas lehrt über bürokratische Überwachungsmethoden, ist nur ein Nebenprodukt. Es ging Kafka um das Rätsel der Lebensaufgabe1, auch als Frage konkreter Schuld, die auf dem Grund der Seele als Vergangenes quälte, und abstrakt als die Sorge, zukünftige Chancen zu vertun. Dahinter verbarg sich kompromisslose Sehnsucht nach Wahrheit, die er als einzige Rechtfertigung einer Existenz als Autor ansah. Es war auch das kindliche Bedürfnis nach Vertrauen: das man erhält und das man der Welt entgegenbringen darf. Doch erlebte er sich zunehmend als dessen nicht würdig, als infektiöser Verdachtsfall. Im ‹Prozess› ruft Josef K. der Vermieterin nach: «Die Reinheit! […] Wenn Sie die Pension rein erhalten wollen, müssen Sie zuerst mir kündigen.»2

Die Lungenkrankheit kostete Kafka im Verein mit der Spanischen Grippe das Leben. 1911 hatte er in einer im Tagebuch vorskizzierten Audienz bei Rudolf Steiner die eigene Disposition noch überraschend direkt charakterisiert. Steiner schien hier für die Autorität einer ‹höheren› Sichtweise zu stehen, wozu Kafka eine Affinität hatte: So sehnte er sich nach einem anderen ‹Stern›, nach objektiver Selbstbeobachtung.3 Mit den Heilungsversuchen und vor allem den Zeiten im Dorf Zürau bei der Schwester Ottla fand eine deutliche Akzentverschiebung statt. Das Befassen mit spirituellen Fragestellungen, einer ‹geistigen Welt›, setzte ein und währte bis zum Tod. Posthum wurde er wie aus dem Nichts zum Dichter der Seele der Moderne. Sein Weg war die ganze Zeit parallel zum Wirken Steiners verlaufen, der seine ‹Philosophie der Freiheit› ‹Seelische Beobachtungsresultate› nannte. Zugehend auf Kafkas 100. Todestag, scheinen wir global auf der Schwelle einer Verwandlung zum Geist hin zu stehen – nur: dem der Maschine oder dem im Kosmos, voneinander gespalten oder beseelt?
Das digitale Denken, sagte kürzlich ein Schauspieler, verlange nach Ja oder Nein. Er habe dem zu folgen versucht, doch er vermisste bald, «was uns Menschen ausmacht: der Graubereich. Und nicht dieses ‹Befehl nicht verstanden›.» Die Vielleicht-Funktion sei die interessanteste.4 Alles, was Kafka ausmachte, war dieser Graubereich, das Vielleicht der Seele, ihre doppelte Ausrichtung, ein Weben in zwei Welten. Es verunsichert Wahrnehmung und Urteil. Erst Anthroposophie deutet die Übergänge zwischen Zentrum und Peripherie, Ich und Ich, Initiative und Schicksal produktiv.
Mein Weg zu Steiner vollzog sich als innerer Umgang mit Kafka – auf der Metaebene, über die eigenen Lebensentscheidungen. Nicht im Korpus der Schrift, sondern vom Rand her, über das, was über ihn hinausragt und der Seele gewohnt ist, wohin sie nach dem Schlaf immer wieder einkehrt. Kafkas ‹Schloss›, der Blick von oben auf sich selbst, blieb seinen Helden unerreichbar, und ihn ruinierte dessen Erschreibenwollen physisch. Doch auch noch sein Scheitern sah Kafka als weises Fazit dialogischer «Verhandlungen zwischen Gehirn und Lunge» auf dem Wege an.5
Mittels der geisteswissenschaftlichen Begriffe (und mithilfe Kafkas) machte ich mir die Grenzen bewusst, an denen Kafka zögerte, nachdem er sich der Theosophie genähert hatte, und zog diese Grenzen als selbst literarisch Publizierender noch einmal nach. Kafkas Denken schien die Anthroposophie auf seine Art, unter anderem Namen, im Herzen erkannt und bewegt zu haben: als sei sie neben ihm mitgelaufen, als Option, die er (als explizite) mied. Als mein eigener Bewusstmachungsprozess auf den Weg gebracht war, wurde ich 2011, in dem Alter, in dem Kafka gestorben war, Vater.
In der Kinder-Sonntagshandlung der Christengemeinschaft dient das Lernen dazu, «die Welt zu verstehen». Manchmal müssen wir auch lernen, die nicht mehr verstehbare Welt zu verlassen, damit der Weg weiterführt: Als ich im Durchgang meines zweiten Mondknotens und vor dem Entschluss, Priester zu werden, einen Monat in Vézelay verbrachte, schrieb mir Peter Handke, es könne dort «auf der ‹Klippe› weit werden, vor allem im Nachtwind, nah der heiligen Magdalena». So ist es. So war es. Ich bin als Mensch selbst die Methode, und ich kann sie bis heute spüren: die Bewegung neben mir, jemanden, der an mein Herz klopft.
Fußnoten
- Siehe: Andreas Laudert, Die vergessene Lebensaufgabe. Von Kafka zu Napoleon. Stuttgart 2011.
- Franz Kafka, Der Prozess. Nach der Kritischen Ausgabe, hrsg. von Hans-Gerd Koch, Frankfurt 1994.
- Franz Kafka, Tagebücher. Band 3, ebd., 24. Januar 2021: «Ich will mich nicht auf bestimmte Weise entwickeln, ich will auf einen andern Platz, das ist in Wahrheit jenes ‹Nach-einem-andern-Stern-wollen›, es würde mir genügen, knapp neben mir zu stehn, es würde mir genügen, den Platz auf dem ich stehe, als einen andern erfassen zu können.»
- nterview mit Charly Hübner, in: ‹Stern›-Jahreschronik 2020.
- Brief an Milena Jesenská, April 1920, hier zit. nach der Studie von Peter Selg, Rainer Maria Rilke und Franz Kafka. Lebensweg und Krankheitsschicksal im 20. Jahrhundert. Dornach 2007 (S. 118).

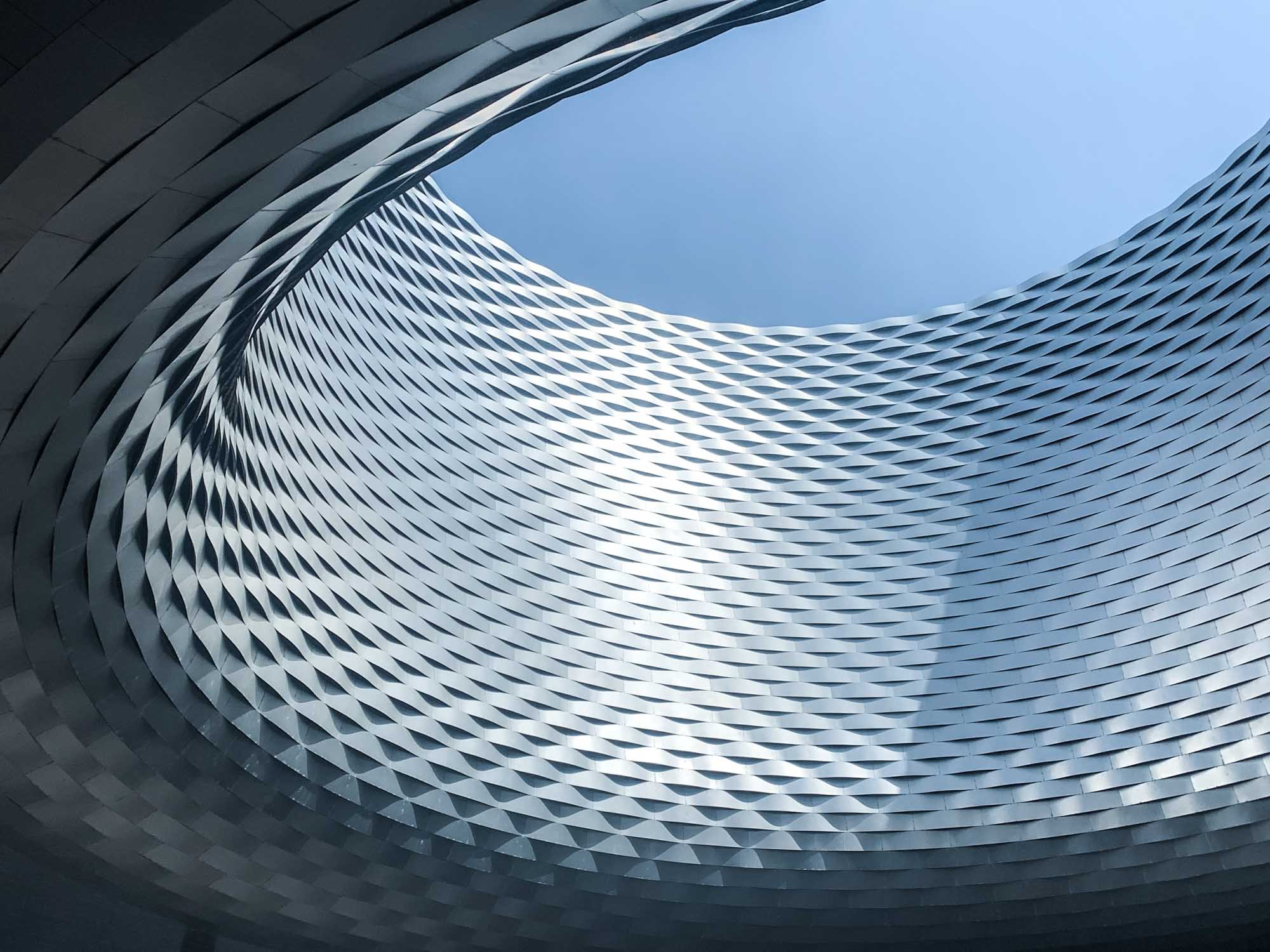


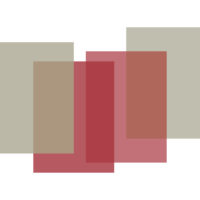

Ich liebe diesen Aufsatz, mit dem ich meine Schwierigkeiten habe. Die Jünger vor Emmaus meinten, den raschen Schwund ihrer Hoffnung zu erleben, dem nichts mehr aufhalten konnte. Aber der Auferstandene öffnete ihnen die Augen. Ein anderes Erkennen fing an in ihnen zu wirken. Lieber Andreas Laudert, auch mir gehen allmählich die Augen auf, über eine Anthroposophie der Zukunft, die in unser heutiges Leben hereinreicht, und zu der die Anthroposophie Rudolf Steiners ebenso gehört, wie sie sich zu ihr als einen Versuch und einen Entwurf verhält. Irre ich mich hierin? Ist sowas vorstellbar? Können wir die Vorstellung einer Anthroposophie bilden, die die geläufigen Vorstellungen von ihr übersteigt? Wer spürt diesen Himmel über uns, dessen Atemhauch den Stirn berührt? Es schwinden die viel bemühten Bilder und es verhallen die alten Redewendungen. Aber die Morgenluft neuer Name und Gesichte! „Wir selber sind ja nichts; nur indem wir das Unbekannte, das kommt, mit dem Alten verbinden, das uns heilig ist, haben wir einen Wert.“, schrieb Hans Carossa, der Kafka las, und staunte. In diesem Sinne möchte ich an Ernst Beernink (1899 – 1978) erinnern, Pfarrer der Christengemeinschaft, den ich sehr geschätzt habe, gerade als Vermittler zwischen den Zeiten. Er lebte in der Anthroposophie wie in der Dichtung, mit einer besonderen Liebe für die Poesie der Emily Dickinson, in die er, wie er mir sagte, ab und zu untertauchte. Unvergesslich ist mir auch seine Reaktion, als ihn in einem Gespräch im Fernsehen gesagt wurde, er sei Anthroposoph: „Zo zou ik dat niet willen zeggen. Ik probeer Antroposoof te wórden“.
Godfried van Ommering
Nl-Odijk
godfriedvanommering@posteo.de