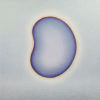Die Junge Bühne am Goetheanum spielt ‹Noch einmal davongekommen› nach Thornton Wilders fast gleichnamiger Vorlage. Das Stück ist für die Coronazeit, denn es bringt den Beinahe-Weltuntergang dreigegliedert auf die Bühne. Ein Gespräch im Theaterlager mit der Regisseurin und Autorin Andrea Pfaehler und dann mit ihren Spielerinnen und Spielern.
Im Mittelpunkt steht die Familie Anthrobus und damit ist, mit den Archetypen Adam und Eva, Kain und Abel sowie Lilith, die ganze Menschheit gemeint. Dreimal muss dieser mikrosoziale Kosmos durch die Krise, durch den Untergang gehen und aus ihm auferstehen. Erst lässt die Eiszeit erfrieren, dann die Sintflut ertrinken und zuletzt den Krieg sterben.
Es habe, so Andrea Pfaehler, die wieder Skript und Regie verantwortet, in keiner der früheren sieben Produktionen so tiefe Gespräche mit den Jugendlichen gegeben, über die Rolle und was diese Rolle mit ihnen zu tun habe. Das mag daran liegen, dass es im Stück um die Frage geht, was für eine Kraft das sei, immer wieder aufzustehen und weiterzugehen. Es mag auch, setzt sie fort, daran liegen, dass Wilder mit dem Stück neben diesen mythischen Rollen drei Ebenen zeigt: die einzelnen Personen, wie Mr. und Mrs. Anthrobus, dann die, die im Stück diese Rolle spielen, und schließlich die Menschen, die diese Schauspieler spielen. Diese Schichten zeigt Wilder, und das habe die Jugendlichen, die dieses Jahr im Durchschnitt etwas älter sind als in den vergangenen Jahren, interessiert. Pfaehler: «Wilder hört dabei immer dann in der Geschichte, in der Rolle auf, wenn jemand sagt: ‹Morgen fange ich an.› Wilder spielt den Ball immer wieder zu uns, das macht das Stück interessant. Es gibt da ja verrückte Momente, wenn eine Bedienstete plötzlich aus der Rolle aussteigt und sich zum Publikum wendend sagt: ‹Ich hasse dieses Stück, weil ich es nicht verstehe.› Das heißt, Wilder bringt das Publikum dazu, sich immer wieder darüber klar zu werden, was man da eigentlich sieht. Obwohl es um große Katastrophen geht, gibt’s einiges zu lachen, aber das Lachen kann uns jeden Moment im Hals stecken bleiben.» Das sei wie der Tanz auf dem Vulkan, der Tanz auf der Titanic: Man dürfe, so Andrea Pfaehler, den Humor nicht verlieren, auch wenn die Welt, wie man sie kennt, untergehe.
Dieses Stück repräsentiert uns alle, die Menschheit, ihre Probleme, so tief und so oberflächlich sie sind – und da findet sich wohl jeder in einer der Rollen wieder.
Aushalten muss ich auch, dass da eine Figur sagt: «Ich wünsche mir den Krieg zurück.» Sie erlebt, dass man im Krieg füreinander da ist, während im Frieden jeder seinen Gartenzaun hochzieht. Dass im ersten Akt die Welt vereist und man deshalb das Feuer nicht ausgehen lassen darf, das versteht Wilder natürlich als seelisches Bild: die Herzen nicht kalt werden zu lassen. Im dritten Akt, dem großen Krieg, da drohe dann Mr. Anthrobus sein Innerstes zu verlieren, bis ihn die menschliche Stimme zurückholt zu sich selbst. So offen das Stück dabei ausgeht, so deutlich ist doch dessen Vision. Berührend ist es, wenn es am Schlus aus dem kriegerischsten von allen herausbricht und er sein Trauma allen erzählt und sie es hören. Das gegenseitige Sehen und Verstehen, das ist es, aus dem sich die Brücke in die Zukunft baut.

Vier Fragen an die Jugendlichen
Was sagt euch das Stück?
«Ganz einfach: Das Stück zeigt mir, weshalb es sich lohnt weiterzugehen, weiterzumachen.» «Die Wand zum Publikum öffnen wir, es wird nicht für, sondern mit dem Publikum gespielt.» «Dieses Stück repräsentiert uns alle, die Menschheit, ihre Probleme, so tief und so oberflächlich sie sind – und da findet sich wohl jeder in einer der Rollen wieder.» «Es ist so lebendig, dieses Stück, ich finde, das kann man nicht proben, dass es dann ‹sitzt›. Weil wir das Publikum mitnehmen, bleibt das Stück eine ewige Probe.» «Das Stück ist ja nicht bis zu Ende geschrieben, das müssen die Zuschauenden, müssen wir selbst außerhalb des Theaters zustande bringen.» «Wir spielen die Familie Anthrobus in drei Krisen in drei Besetzungen. Wenn ich am Anfang spiele, dann weiß ich, dass sich meine Figur noch entwickelt. Ich gebe etwas weiter, im Vertrauen darauf, dass er oder sie es weiterführt.»
Krise, Untergang, Apokalypse, was heißt das für euch?
«Krise, dieses Wort ist ja heute zu viel und zu oft benutzt. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie es ist, wenn morgen alles zu Ende sein könnte, und zugleich zeigt mir die Coronakrise, dass ich nicht mehr so einfach in die Zukunft schauen kann.» «Im Stück heißt es, dass die Flut kommt und wir deshalb aufs Boot müssen. Wie es ist, auf dem Boot auf dem Meer zu treiben, wie jetzt viele von Libyen, das spielen wir ja nicht. Die Krise kommt, ist aber noch nicht da, nicht greifbar. Das ist genau das, wo wir im echten Leben durchmüssen: Da baut sich eine Krise auf, aber wie wir das Problem wirklich lösen, das steht noch vor uns.» «Wir in der Schweiz, wir sind ja gar nicht in der Krise, auch das Publikum nicht wirklich, das sind ja andere, in anderen Ländern. Das Stück hilft mir, mich mit denen, die wirklich jetzt nicht weiterwissen, verbunden zu fühlen. Das ist wichtig.»

Im Stück mischt sich Weltuntergang mit Cocktail-Empfang, man will sich retten und sich amüsieren. Sind wir so?
«Wenn ich eine Zeitung aufschlage, steht auf einer Seite, wie viele Menschen aus Afrika gerade auf dem Mittelmeer verzweifeln, und auf der nächsten Seite lese ich ein Rezept für den neusten Fruchtsalat. Das ist wirklich so.» «Im zweiten Akt ist ja von solchen banalen Dingen die Rede. Der Präsident spricht darüber, wie schmackhaft Tomaten sind. Wie eine Wasserrutsche führt dieses oberflächliche Gerede dann immer weiter in den Abgrund.» «Dass wir aus unserer Rolle aussteigen, das wird im Lauf der Handlung immer weniger. Was am Anfang nur ein Spiel ist, das wird existenziell. Davon können wir wohl einiges lernen, dass das, was wir spielen, was wir als Spaß nehmen, dann doch eine sehr ernste Seite hat. Es heißt wohl auch, dass wir unser Spiel ernst nehmen sollen.»
Wie besteht man in der Krise, was rät das Stück für Resilienz?
«Um eine Krise bestehen zu können, ist das beste, wie es auch im Stück immer wieder heißt, dass man nicht vergisst, dass es ein ‹nach der Krise› gibt.» «Das sagt ja auch Mrs. Anthrobus im 3. Akt: ‹Ich könnte 70 Jahre in einem Kellerloch stecken, ich würde doch an ein Danach glauben.› Sie hält sich an dieser Hoffnung an die Zukunft, an die Menschheit fest.» «Im 1. Akt rücken sie zusammen, um sich zu wärmen. Im 2. Akt bilden sie eine Kette – ja, in der Krise zu bestehen, heißt, gemeinsam in der Krise zu sein. Im 3. Akt lauschen sie Henrys Geschichte, seinem Trauma und sein Vater bekennt, dass er dabei seinen Anteil hat. Hier halten alle innerlich zusammen.» «Es ist komisch: Die Krise droht alles kaputt zu machen und doch bringt gerade sie unser Bestes hervor, unsere Kraft, unseren Witz, unsere Liebe.»