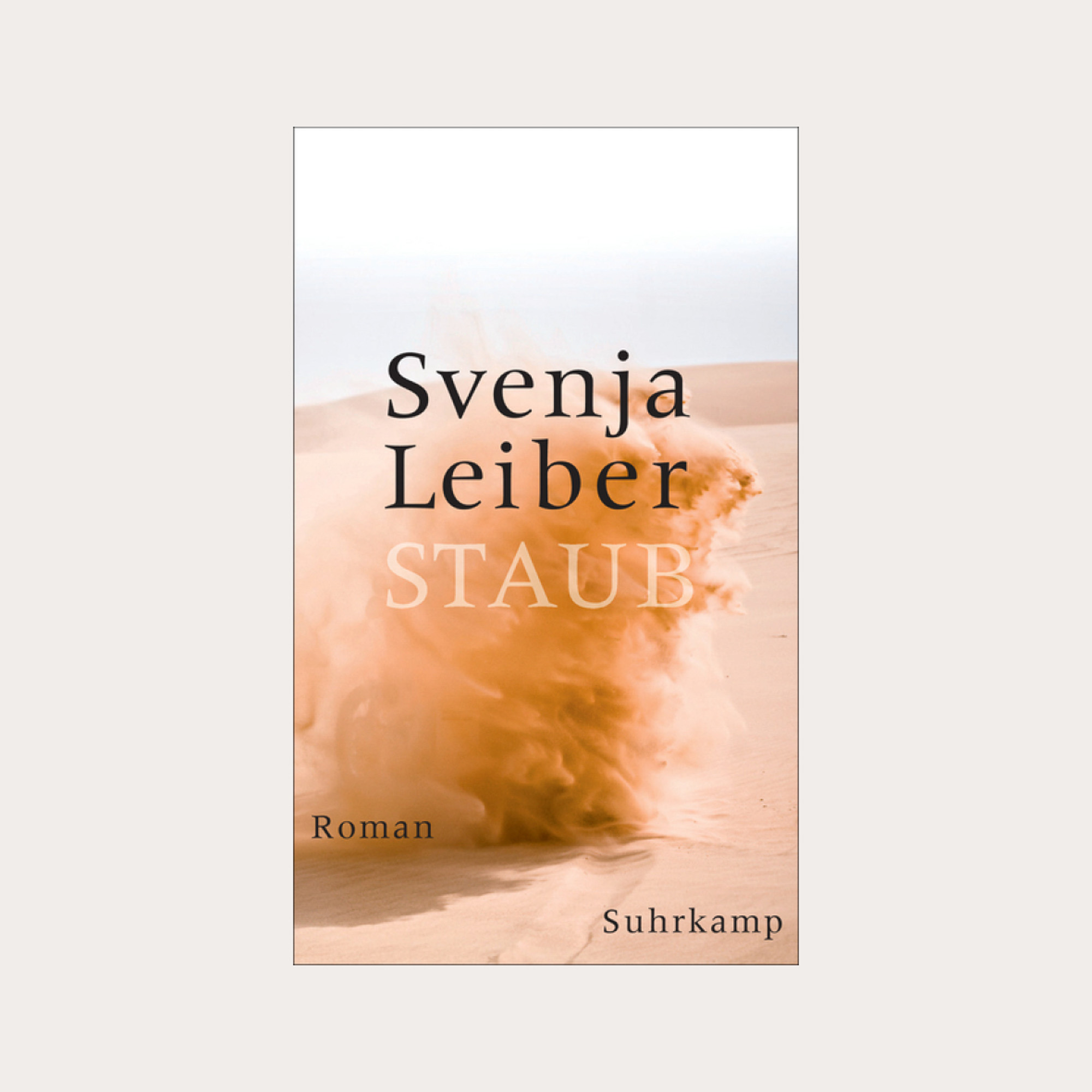Im März dieses Jahres zur Leipziger Buchmesse erschien im Suhrkamp-Verlag Svenja Leibers neuer Roman ‹Staub›. Der Ich-Erzähler ist ein Mann mittleren Alters, der sich aus einer krisenhaften Situation heraus auf eine Reise in den Nahen Osten begibt.
Das ist eine Parallele zum ersten Roman der Autorin, ‹Schipino›, in dem ein deutscher Anwalt seine Krise in einem russischen Dorf zu heilen versucht. In ihrem zweiten und bisher erfolgreichsten Roman ‹Das letzte Land› wird die Lebensgeschichte eines Anfang des 20. Jahrhunderts in einem Dorf bei Lübeck geborenen Violinisten erzählt, der sich aus dem ländlichen Milieu herausarbeitet, dann aber privat und beruflich, bedingt durch den Nationalsozialismus und den Krieg, scheitert.
In ‹Staub› hingegen zieht es den Erzähler, einen Berliner Arzt, zunächst nach Jordanien, wo er einen Studienfreund besucht. Zugleich ist es aber eine Reise in die eigene Vergangenheit, da er als Kind eine Zeit mit seiner Familie in Riad verbracht hat, wo der Vater vorübergehend als Arzt arbeitete. Die Wiederbegegnung mit der arabisch-muslimischen Welt lässt in ihm die Erinnerung an die Kindheitserlebnisse in Saudi-Arabien aufleben, die als eine weitere Zeitebene parallel erzählt werden. Die äußere Reise wird so zugleich zu einer inneren und zudem zu einer Erforschung der geistigen Gestalt des Nahen Ostens.
Auf der in Riad 1985 verorteten Handlungsebene ist das zentrale Ereignis der Verlust der jüngeren Schwester, die sich als Junge fühlt – oder eigentlich jenseits von Geschlechtlichkeit – und Semjon genannt wird. Nach einer gemeinsamen Fahrt von Mutter und Kindern im städtischen Bus ist sie nicht mit ausgestiegen und wird vermisst. Am nächsten Tag taucht sie nach vielem Sorgen und Suchen der Familie wieder auf, trägt aber einen weiblichen Schmuck und wirkt abwesend und verwirrt. Nach der Rückkehr der Familie nach Deutschland zieht sie sich immer mehr zurück und stirbt schließlich. Ihre Reinheit und geringe Erdverbundenheit erinnern einerseits an Abel – Semjon liebt Schafherden – und andererseits an Goethes ‹Mignon›. Damit ist ein wesentliches Motiv dieses Romans angesprochen: Kindheitskräfte in einer alten Welt, einerseits Heilung versprechend, andererseits von Missbrauch und Vergreisung bedroht.
Bald taucht in Form einer Abbildung, die an der Wand des Freundes in Amman hängt, einer von vielen kulturellen Verweisen auf: Borgognones Darstellung der zwei Jesusknaben im Tempel. Unschuld und Erfahrung begegnen sich, um das größte Mysterium zu ermöglichen: Inkarnation, Tod und Auferstehung von Gottes Sohn. Demgegenüber stehen die uralte Kulturregion des Nahen Ostens und ein Glaube, der genau dieses Mysterium nicht anerkennt: Im Islam hat Gott keinen Sohn, kann nicht sterben und nicht auferstehen.
Auf der Zeitebene des Romans, die 2014 in Jordanien spielt, fokussiert sich die Handlung immer mehr auf den Heilungsversuch eines Kindes namens Alim, das durch eine unerklärliche Krankheit wie ein Greis aussieht und dessen Bewegungen auf halber Strecke ins Stocken geraten, wie ein blockierter Wille. Mitunter wirkt er wie ein Symbol für eine Kultur, die zugleich uralt und kindlich ist, dabei aber in ihrer Entwicklung wie gelähmt erscheint. Nachdem weder die moderne Schulmedizin noch eine pflanzliche Therapie wirklich heilen konnten, verschwindet auch Alim mit seiner Spielgefährtin Gili in Jerusalem. Der Protagonist ist wieder – Reminiszenz an seine Kindheitserfahrung in Riad – auf der Suche nach dem verlorenen Kind. Dabei wirkt Alim wie eine Verzerrung der Verbindung von Unschuld und Erfahrung: Ein vergreistes Kind. In der Nähe des tiefsten Punktes der Erde, im Jordantal – «… wir sind am Tiefpunkt der Parabel …» – nahe der Stelle von Jesu Taufe durch Johannes, findet der Ich-Erzähler schließlich Alim und Gili wieder, während eines Sandsturms. Damit endet der Roman und lässt den Leser in einer vagen Hoffnung auf einen Neubeginn in einer zu «Staub» zerfallenden Welt zurück.
Die Autorin hat uns Spuren in den Sand gelegt, die zum Verständnis einer Region beitragen könnten, die uns nicht in Ruhe lässt, weil sie einfach keinen Frieden findet. Drei große Weltreligionen haben hier ihren Ursprung und finden keinen Frieden miteinander. Während Lessing uns im ‹Nathan› mit der Weisheit der Ringparabel eine der wichtigsten Früchte der Aufklärung hinterlassen hat: die Toleranz der Religionen untereinander, klingt in ‹Staub› noch eine andere Schicht mit an: Gibt es einen qualitativen Unterschied zwischen einer reinen Vater-Religion und einer solchen, die Gott einen Sohn zuschreibt, der sich mit dem Schicksal der Erde und der Menschen quasi ‹persönlich› verbindet; hat das Auswirkungen auf den Blick auf das Kind, die Erde und das Individuum? Gibt es göttliche Heilungskräfte, die im irdischen Leben und der Natur wirksam werden können? Der Protagonist von ‹Staub›, ein suchtkranker Arzt aus Berlin, scheint auf der Suche nach diesen Kräften zu sein, aber selbst in Jerusalem findet er sie nicht. Erst als er am Jordan ganz zu sich selbst kommt, findet er die Kinder wieder. Kann der kranke Heiler geheilt werden?
Das Besondere an Svenja Leibers Stil ist, dass sowohl die erzählte Welt als auch die Sprache zwischen sehr grob und sehr fein oszillieren und dabei immer wieder tiefere Schichten durchscheinen lassen. Obwohl die Protagonisten aller drei Romane Scheiternde sind, entsteht keine hoffnungslose Stimmung. Vielmehr scheint das Scheitern als originär menschliche Erfahrung einen Sinn zu erhalten, der aber im Verborgenen bleibt.
Svenja Leiber: ‹Staub›, Frankfurt a. M. 2018