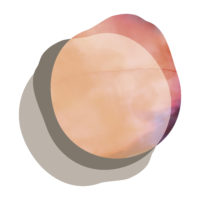Das aktuelle Buch von Peter Handke hat erneut ein Bild aus den Evangelien im Fokus. Dieses Mal geht es um Selbstwerdung und Verwandlung.
Ein erstaunlicher Schriftsteller ist Peter Handke! In seinem Schaffen und Schreiben bilden sich Lebensstufen ab. Darüber hatte Florian Roder in seinem Mondknotenband geforscht. In Handkes letztem Buch ‹Das zweite Schwert› wurde dies bereits deutlich. Damals zeigte sich, dass ein Text aus dem Lukasevangelium im inneren Zentrum stand. In seiner neuen Erzählung ist es das Markusevangelium, die Austreibung des Dämons am See Genezareth. Diesmal geschieht der christliche Bezug im Hinblick auf Selbstwerdung, Selbstverwandlung. Nach der stürmischen Zeit der Nobelpreisvergabe, des Durchlaufens des vierten Mondknotens, schildert Peter Handke, wie er diese Lebenskämpfe hinter sich lässt und der menschlichen Gemeinschaft wiedergegeben wird: «Ich, Idiot, ins Gemeinwesen gestellt», lautet das Pindar-Wort, das dem Text vorangestellt ist.
Dämon – das kann zweierlei meinen. Ein Beängstigendes, das die Seele bedrängt, oder auch im ursprünglichen Sinn: Leitstern, Genius. Handke nennt sein neues Buch ‹Eine Dämonengeschichte›. Es handelt vom eignen Ich, er betont, er habe davon noch nie berichtet. Diese Selbsterfahrung spielt sich in drei Kapiteln ab: einem ersten, von dem er selber nur aus Erzählungen seiner Schwester – wir können sie als seine Seele verstehen – weiß, da er nicht bei sich, außer sich, ein Wahnbesessener gewesen sei; einem zweiten, das er in der Ich-Form erlebt; einem dritten, das traumhaft Zukunft schildert. Der Zeitlauf schildert Biografisches, schildert aber auch Schwelle, Durchgang zu neuem Sein. Das können Jugend und Alter. Es mag auch die stürmische Konfrontation mit der Öffentlichkeit sein, wie sie der Dichter 2019 erlebt hatte.
Vom anthroposophischen Gesichtspunkt aus interessiert: Wie durchlebt Handke diese Verwandlungen, und was drückt sich darin in seinem Ich-Erleben aus? Es interessiert, natürlich, die geistig-spirituelle Seite – und die ist reich!
Man darf gar nicht fragen, was da geschehe, was es bedeute, sonst bleibt man verloren in diesem rätselhaften Text. Aber man darf staunend, denn die Bilder wirken, sich von der Magie der sprachschöpferischen Kraft mitreißen lassen. Handke erklärt nichts, er stellt Innerstes dar. Nennt sich einen «Obstgärtner von je», einen also, der seinen Garten pflegt, Früchte erntet, sie weitergibt, von Jugend an, Keime und Samen anlegt.
Diese Innenschau schafft sich eine bildmächtige, nahezu biblische Sprache: «War es vielleicht die sogenannte Wesensschau? – Wesen mag gelten – nicht aber Schau» oder «und im Waldhintergrund, in der Baumkronenferne, der Himmel als dort aufgehängte blaue Hemden, ein blaues Hemd ums andere». Wer bin ich wirklich, was gelte ich andern? «Ich wurde, der Reihe nach, für einen vormals landweit bekannten Schanzenspringer gehalten, den Barpianisten vom Grand Hotel, einen Star-Anwalt, einen Fußball-Schiedsrichter, […] einen Begräbnisunternehmer (wegen meines schwarzen Anzugs und weißen Hemds?), sogar einen Notar», die Rollen also, die wir in unseren Kostümen spielen, sind beliebige. «Saumseligkeit: als Seligsein an den Rändern und Säumen, als, eher, aus Eigenmacht, bei mir allein – eine dritte Spielart der Saumseligkeit dazutrat: jene beim Gewahrwerden der fernsten Säume.» Und dadurch Wandlung bis aufs Blut. «‹Gibt es je eine Rückfahrt?›, so wandte ich mich zu ihm –, ‹so sollst du mein Blut nicht mehr verschmähen. Es soll dir dann schmecken, mein Blut – das Blut des Gesandten des Guten Zuschauers.›»

Dieser Gute Zuschauer – ist Christus. Die Begegnung mit ihm ist das zentrale Agens, die Peripetie der Erzählung – der Augenblick, da der Dämon aus dem Obstgärtner fährt, die große Heilung! «Was mich weckte und mich zurück zu mir von früher kommen ließ, das waren die Augen des einen Mannes, welcher in der Mitte des Halbkreises stand. […] Und ich fühlte, nein, wusste mich von diesen Augen angeblickt, wie ich noch keinmal von einem Menschen angeblickt worden war. […] Da war er endlich, der Gute Zuschauer, wie er mir all die Zeit meines Wahns so notgetan hatte. Und wahrhaftig, im Nu war ich ihn los, den Dämon; fuhren sie aus mir, die Dämonen. Von Gestank dabei freilich keine Rede. Es war, als ob sie eher bloß so verduftet seien.»
Diese Begegnung am See geschieht, auch von der Seitenzahl her, in der genauen Mitte der Erzählung. Bis dahin: «Sitzen auf der Schwelle, auf jener granitenen Schwelle […] wie ich damals als der Schwellenhocker gewesen war […] nichts zu sehen in der Erinnerung, weder die Schwelle noch mich, nur eben zu spüren: mein Sitzen.»
Und danach: Fahrt lautlos, «über den See, den großen Teich, der, sehr früher einmal, Meer geheißen hatte. Unser Meer, die Uferlinie des anderen Landes gleich in Sichtweite.» Es liegt auf der Hand, was der Dichter damit evozieren will: Schwellen-Situation, Erweckung, Genezareth, Aufbruch ins andere Land – gibt es von da je eine Rückfahrt? – Siehe weiter oben.
Peter Handke, der Hermetiker unserer Gegenwartsliteratur, erzählt von seligem Eintritt in das ‹neue Paradies›, wo Pflanzen, Tiere noch keine Namen tragen, ich muss sie ihnen erst geben. Daher trägt niemand in dieser Geschichte bereits einen Namen – es gibt das Kind, die Greisin, den Guten Zuschauer, die Schwester. Das ist auf höchstem Niveau Sprachkunst: Gärtnerarbeit an den Imaginationskräften. Der alte Handke will der Welt hier zeigen, wer er wirklich ist; fragen, ob wir ihn auch erkennen.
Der letzte Satz der Erzählung lautet: «[…], jetzt ein klares Rufen, hinein in die Leere: Seid ihr alle da?»
Peter Handke, Mein Tag im anderen Land, Suhrkamp, Berlin 2021