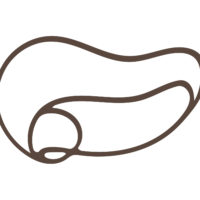Über die Verantwortung von Leben und Tod.
Die Coronakrise stellt auch die Frage nach unserem Verhältnis zum Sterben. Das Sterben wollen wir im Augenblick dringlichst vermeiden. Dass wir sterblich sind (und keine Religion mehr haben, die uns diesen Gedanken erträglich macht), ist so nah an uns herangetreten mit dem Virus, wie wir es lange nicht mehr vor Augen hatten. Und erst recht wollen wir vermeiden, in eine Situation zu geraten, wo jemand die Entscheidung treffen muss, wer stirbt und wer leben darf. Die ‹Maßnahmen› können in ihrer Konsequenz als Verhinderung dieses Entscheidens verstanden werden. Und ja: Ich wollte diese Entscheidung auch nicht treffen müssen, als Ärztin oder Politikerin.
Die Verantwortung für den eventuellen Tod des anderen wird dabei als moralisches Argument verwendet, dessen Tragweite in unseren Weltverhältnissen viel größer ist als nur aus der Sorge um mich und meine Unmittelbarkeit geschaut. Wenn die Coronakrise alle Probleme und Diskrepanzen verschärft und an die Oberfläche spült, die die Erde schon seit Jahrzehnten im ökosozialen Gleichgewicht zerstören, dann auch den Tod, den wir an anderen zu verantworten haben. Es sterben täglich Menschen an den Auswirkungen von Pestiziden für Bananen von sonstwo, die wir billig im Supermarkt erwerben wollen. Es sterben Menschen an Hungerslöhnen, weil sie Stoffe färben mit Gerbstoffen, die ihre Lungen zerfressen, damit wir in Textildiscountern für 5 Franken T-Shirts erwerben können. Es sterben täglich Millionen von Rindern in Massentierhaltung, damit wir für 5 Euro Steaks kaufen können jeden Tag. Wir leben immer im Angesicht dessen, dass andere sterben.
Ich wünschte, die Verantwortung für den Tod von anderen würde sich so weiten können, dass sie daraus als Kraft der Verantwortung für das Leben von anderen hervorgehen kann. Dass nicht angsterfüllter Vorwurf mir entgegentritt, sondern ein Wille zum gemeinsamen und gleichwertigen Leben und Sterben. Oder sollen wir heute nicht mehr sterben und auch nicht mehr leben dürfen?
Bild: Sofia Lismont