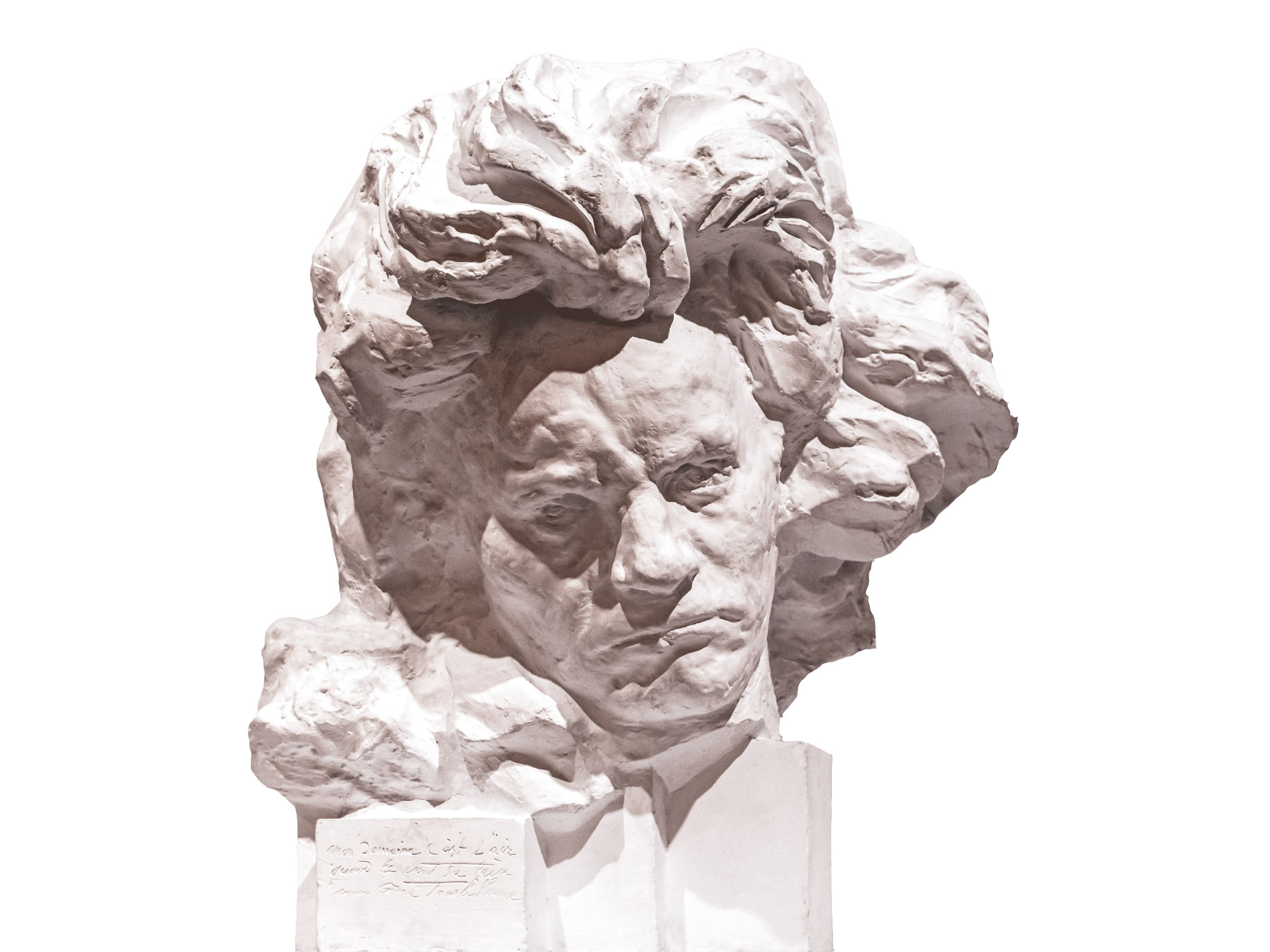Er führte die Klassik in die Romantik, wendete die Musik von der Feier des Menschen im Kosmos zur Feier des Kosmos in uns Menschen. Seine 9. Sinfonie ist die Hymne Europas, sein ganzes Werk ist der Ruf zur Selbstbefreiung, ein Hineinhören in diesen Ab- und Aufstieg der Seele. Vor 250 Jahren, am 17. Dezember 1780, wurde er in Bonn getauft.
Missglückte Begegnung mit Goethe
Das einzige Treffen Beethovens mit Goethe fand in Teplitz statt. Beethoven steht im 42. Lebensjahr und hat noch von Prag aus Karl August Varnhagen von Ense, den Diplomaten und Schriftsteller, gebeten, die Begegnung vorzubereiten. Dieser kam dem Wunsch des Meisters nach und setzte Goethe in Kenntnis, Beethoven werde «aufs neue die Heilkräfte des Töplitzer Bades gegen seine unglückliche Taubheit versuchen, die seiner angeborenen Wildheit nur zu günstig ist und ihn für Solche, deren Liebe er nicht schon vertraut, fast ungesellig macht; für musikalische Töne behält er nichtsdestoweniger die leiseste Empfindlichkeit, und von jedem Gespräch vernimmt er, wenn auch nicht die Worte, doch die Melodie […]» Noch am Tag der erfolgten Begegnung, dem 19. Juli 1812, schrieb Goethe abends an seine Frau die Sätze: «Zusammengeraffter, energischer, inniger habe ich noch keinen Künstler gesehen. Ich begreife recht gut, wie der gegen die Welt wunderlich stehen muß.» Die Anekdoten um diese Begegnung, nach Jahren eitel und geschwätzig durch Bettina von Arnim ausgestreut, kann man beiseite lassen. Die beiden Protagonisten haben aber ihr Zusammentreffen nach wenigen Tagen kontrapunktisch referiert; Goethe, an Freund Zelter in Berlin: «Sein Talent hat mich in Erstaunen gesetzt; allein er ist leider eine ganz ungebändigte Persönlichkeit, die zwar nicht unrecht hat, wenn sie die Welt detestabel findet, aber sie dadurch freilich weder für sich noch für andere genußreicher macht. Sehr zu entschuldigen ist er hingegen und sehr zu bedauern, da ihn sein Gehör verläßt, das vielleicht dem musikalischen Teil seines Wesens weniger als dem geselligen schadet.» Beethoven, an Verleger Härtel in Leipzig: «Göthe behagt die hofluft zu sehr – mehr als einem Dichter ziemt. Es ist nicht viel mehr über die Lächerlichkeiten der Virtuosen hier zu reden, wenn Dichter, die als die ersten Lehrer der Nation angesehen seyn sollten, über diesem Schimmer alles andere vergessen können.»
Herkunft, Stellung, die Wirkung der persönlichen Doppelgänger hatten einer tieferen Begegnung beider offenbar im Wege gestanden; ihrer gegenseitigen künstlerischen Hochachtung tat dies keinen Abbruch. Ein Jahr später sollte Beethoven mit ‹Wellingtons Sieg› und der ‹Siebten Sinfonie› den Gipfel seiner äußeren Laufbahn erreichen: Wien lag ihm zu Füßen. Goethe schrieb das Gedicht ‹Ich ging im Walde so für mich hin› und beendete Band III von ‹Dichtung und Wahrheit›. Für uns entscheidend sind hier die gegenseitigen, zeitnahen Charakterisierungen. Es ist wahrzunehmen: Beide lebten ganz verschiedene Daseinsformen, die Umstände und Bedingungen ihrer Existenz waren verschieden. Außerdem trennte sie ein Altersabstand von 21 Jahren. Was, wenn Beethoven auf Schiller getroffen wäre? – Aber dieser war bereits seit sieben Jahren verstorben.
Kometenhafter Einstieg in Wien
Seit seinem 21. Jahr galt Beethoven als revolutionär, genial und unvergleichbar. Bereits in den Jugendsonaten von 1783 zeigt sich die unverwechselbare Formkraft des 13-Jährigen: Metamorphose der Themen, gedankenreiche Verknüpfung von Einleitungen und Durchführung im Hauptsatz, schroffe Polarisierung weicher/harter, dur-/moll-, männlich/weiblich bestimmter Melodik, Emanzipation der rhythmischen Begleitung, Entschiedenheit der Aussage ohne spielerisches Beiwerk – also all die Bausteine, die eine Architektur Beethoven’scher Prägung aufs erste Hören kenntlich machen.
Als er mit 22 Jahren nach Wien übersiedelt, auf der Reise den Revolutionsheeren der Napoleon-Kriege begegnet, trägt er das Empfehlungsschreiben der Bonner Aristokratie im Gepäck: «Lieber Beethoven! Sie gehen jetzt nach Wien, wo sich ihre so lange vergeblichen Wünsche erfüllen werden. Mozarts Genius trauert und weint über den Tod seines Schülers. Er hat wohl eine Zuflucht bei dem unerschöpflichen Haydn gefunden – aber keine Beschäftigung. Durch fleißige Arbeit werden Sie Mozarts Geist aus Haydns Händen empfangen.» Der Dreiklang der Wiener Klassik als Epoche Haydns – damals ein 60-Jähriger –, Mozarts – damals soeben verstorben – und Beethovens – ein 20-Jähriger – stand also von Anfang an fest. Jener Brief formuliert als erstes Dokument die Trias Haydn – Mozart – Beethoven.
Schon zu Beginn des Wiener Schaffens taucht das Prometheus-Motiv auf. In ihm konzentrieren sich alle Erwartungen und Projektionen, die Beethoven mitbringt in eine Stadt, wo laut Rudolf Steiner «ein Kompendium der ganzen europäischen Bodenverhältnisse ist», wo in der Geologie «angelegt eigentlich die Tonleitern sind – nicht wahr: chemische Äquivalentgewichte sind eigentlich Tonverhältnisse –, wo ein solches seelisch-geistiges Milieu ist, in dem besonders musikalische Genies sich ansässig machen und sympathisch berührt fühlen müssen». Es sind diese beiden Komponenten: die atmosphärischen Verhältnisse, die Erwartung der Mozart-Nachfolge, die das Prometheus-Bild schon früh befestigen.

Nun fügt sich in dieses Bild ein Vierfaches. Zum einen komponiert Beethoven eine Ballettmusik ‹Die Geschöpfe des Prometheus›; hier erschreckt er die Hörerschaft bereits damit, dass im Anfangsakkord C-Dur ein dissonantes b in den Bässen erklingt. Darüber berichtete Schindler: «Über die Fata dieses Akkords wußte Beethoven zu erzählen, daß, was sich bis dahin im Gremio der alten Wiener Tonlehre noch nicht zu seinen erklärten Gegnern gezählt, dieser Akkord es bewirkt habe […]», ein Fehdehandschuh gleichsam, in Gestalt eines Sekundakkords, hineingeworfen in die Arena des Wiener Musiklebens. Des Weiteren veröffentlicht Beethoven mit Opus 35 die ‹Prometheus – Variationen›; es handelt sich um ein Thema, das im Ballett bereits auftritt, dann in der ‹3. Sinfonie› als Eroica-Thema berühmt werden sollte und womit sich Beethoven als Schöpfer einer ‹neu gefundenen Methode› einführt. Drittens verbindet er dieses Werk mit einer Polemik gegen oberflächlichen französischen Geschmack: «statt allem Geschrey von einer Neuen Methode von Variationen, wie es unsere Nachbarn die gallo-Franken machen würden, wie zu B. mir ein gewisser französischer Componist Fugen presentirte apres une nouvelle methode, welche darin besteht, daß die Fuge keine Fuge mehr ist.» Viertens war es nichts geworden mit der Schülerschaft bei Haydn – Beethoven hatte sie bald aufgekündigt. Zu sehr erschien ihm des Lehrers Musizieren als gefällig, zu wenig modern, zu seinem prometheischen Anspruch einfach nicht passend.
Dies verdichtet sich ins Bild eines kometenhaften Künstlertums, das nun mit der voranschreitenden Ertaubung ab 1801, mit der Abfassung des privaten Dokumentes ‹Heiligenstädter Testament› vom Oktober 1802, mehr und mehr an Heldentum, an Leiden und titanenhafter Isolation als seinem endgültigen Profil gewinnen sollte. Darin allerdings steht er Schiller näher als Goethe, was auch erklärt, weshalb sich das Teplitzer Treffen nicht just glücklich gestaltete.
Laß dir sagen, ich neige mehr und mehr zu dem Eingeständnis, daß es schon etwas Eigentümliches ist um eure Musik. Eine Bekundung höchster Tatkraft – nichts weniger als abstrakt, aber gegenstandslos, einer Tatkraft im Reinen, im klaren Äther.
Prometheus-Motiv
Seine künstlerische Entwicklung hat Beethoven immer mehr durch Philosophie, Humanität, Freiheitsidealismus und insbesondere Schiller-Studium begleitet. Es finden sich in seiner Bibliothek die Zeugen der Beschäftigung mit Schillers ‹Über die ästhetische Erziehung des Menschen›, mit Benjamin Franklins ‹Amerikanischer Revolution›, mit Kant – der schon 1756 Franklin einen «Prometheus der neueren Zeit» genannt hatte. Der amerikanische Beethoven-Biograf Alexander Wheelock Thayer beschreibt, wie sich der Komponist an Cincinnatus, Scipio, Cato, Washington, Franklin orientierte, wie er sich am Studium alter und neuer Klassiker, namentlich Plutarch, Homer, Shakespeare, aufrichtete, in ihnen die würdigen Vorbilder für sein eigenes Leben sah. Beethoven besaß Herders ‹Voraussicht und Zurücksicht›, ein literarisches Gespräch zwischen Prometheus, Epimetheus, Pallas Athene. Er kannte den Nekrolog Georg Forsters auf Franklin – Forster war weltgereister Naturforscher, Lehrer Alexander von Humboldts, ein Phänomenologe, der, wie Goethe, mit Kant seine liebe Not hatte und ihm eine Stubenhocker-Gelehrsamkeit vorwarf; bei eben diesem Georg Forster fand Beethoven erstmals die Formulierung vom ‹Götterfunken Vernunft›, Sätze wie «Die Freiheit ist nur der Tugend erreichbar, Tugend nur möglich durch Vernunft»; «seid einig, wie es Brüdern ziemt, seid weise: dann erreicht ihr das der Menschheit vorgesteckte Ziel»; «Willkür und Gewalt verschwinden»; «ihr werdet glücklich – ihr seid frei!» Dies ist das Gedankengut, in dem Beethoven und sein engerer Wiener Freundeskreis lebten. Bereits 1793 schreibt er seiner Freundin Theodora J. Vocke ins Stammbuch: «Wohltun, wo man kann, Freiheit über alles lieben, Wahrheit nie, auch sogar am Throne nicht verleugnen». Hier klingt Nähe an zu Schillers ‹Don Carlos›. Der 24-jährige Beethoven ruft in einem Brief an den Verleger Simrock aus: «Man darf nicht zu laut sprechen hier, sonst gibt die Polizei einem Quartier.»
Daher ist verständlich: Der Freiheitsidealismus wurzelt tief in ihm – wirksam über die Jahre hinweg, so im ‹Fidelio›: «Wahrheit wagt ich kühn zu sagen, und die Ketten sind mein Lohn», so in der 20 Jahre vor der ‹9. Sinfonie› notierten ‹Ode an die Freude› von Schiller, wo die Gedankenbilder ‹Götterfunke› und ‹alle Menschen werden Brüder› oder ‹überm Sternenzelt muß ein lieber Vater wohnen› wieder aufgegriffen werden.
In Vorträgen von Januar und Juni 1908 hat Rudolf Steiner mehrere Gedanken bearbeitet, die äußerst hilfreich sind, um Beethoven tiefer zu verstehen. Diese können hier nicht alle referiert werden. Es handelt sich im Wesentlichen um: Prometheus als Repräsentanten der gegenwärtigen Kulturepoche; das Verhältnis von Sprache und Musik; Richard Wagners Jubiläumsschrift ‹Beethoven› von 1870 zum 100. Jubiläum sowie die Bedeutung der ‹Leber des Prometheus› – allesamt in Band 102 der Rudolf-Steiner-Gesamtausgabe versammelt. Erstens ist Prometheus derjenige der Titanen, der das Feuer vom Himmel geholt, der Menschheit damit Freiheit, Individualität, Wissenschaft und Kunst gebracht hat und dafür 30 Jahre lang an den Felsen des Kaukasus geschmiedet wurde. Ich sage dazu: so, wie Beethovens Hör-Sinn an das Felsenbein des Schädelknochens angeschmiedet war und nicht mehr freikam. Dadurch aber steigerte sich das innere Hören ins bisher buchstäblich Un-Erhörte. Die Fähigkeit der Verstandesseele, nächtliche Erlebnisse in der Geistwelt des Devachan umzusetzen in irdische Musik, und die Fähigkeit der Bewusstseinsseele, solche Erfahrungen ins Wort, in Poesie zu prägen: diese beiden Elemente kommen durch Beethovens Schaffen wieder zusammen. Die Musik findet wieder zum Wort beziehungsweise sie beginnt, sprechend zu werden. Es reicht nicht, dazu Wortvertonungen beizuziehen: Beethovens ganzes Schaffen ist Sprache, und eben dies hatte, drittens, Richard Wagner erkannt in seiner «genialen» (Steiner) Beethoven-Schrift. Der Meister ist nicht mehr Compositeur im herkömmlichen Sinne, er ist Tondichter.
Wohltun, wo man kann, Freiheit über alles lieben, Wahrheit nie, auch sogar am Throne nicht verleugnen
Beethoven an Theodora Vocke
Schließlich interessiert uns der Leberbefund. Bei Obduktion nach Beethovens Tod stellte sich der Zustand der Leber als massiv geschrumpft und verhärtet dar – obschon Beethoven ja kein Alkoholiker, Trinker, wie etwa sein Vater, gewesen war. Die Leber aber schildert Rudolf Steiner als das Organ des Willens, der Wärme, der Inspiration: «In der Leber sind in der Tat diejenigen Kräfte des Menschen verankert, über die der Mensch immer mehr und mehr hinauswachsen muß […] sie ist dasjenige Organ, das die Kräfte enthält, die der Mensch am meisten überwinden muß.» – Dieser Zusammenhang war schon dem Arzt Eugen Kolisko aufgefallen, der darüber 1938 in ‹Modern Mystic› publiziert hatte.
Vor allem wird dadurch verständlich, wodurch Beethoven so sehr als prometheisch wahrgenommen wurde: Der Götterfunke, angeschmiedet an den mineralischen Körper, das Leiden am Verlust der Sinneswahrnehmung, die titanenhafte Steigerung des inneren Hörens – und die Aufzehrung der Willens- und Leberkraft durch radikal individuelles Schöpfertum.
Wille – als Bekundung reiner Tatkraft
Thomas Mann nimmt in seinem Spätwerk ‹Doktor Faustus› mehrfach Bezug auf Beethoven, da ja der Roman ein modernes Musikerleben zum Inhalt hat. Dort findet sich im 18. Kapitel eine grandiose Schilderung der Ouvertüre Nr. 3 der Oper ‹Leonore›, in einem Gespräch des Musikers Leverkühn mit seinem Freund Serenus. Es nötigt Bewunderung ab, wie zielsicher Thomas Mann hier eben diese Willenhaftigkeit der Beethoven’schen Tondichtung charakterisiert, wobei ihm wohl Schopenhauer zu dieser Erkenntnis mitverholfen haben wird.
Die Freunde haben also diese Ouvertüre gehört. Daraufhin sagt Leverkühn zu seinem Studienkollegen: «Lieber Freund, wahrscheinlich hat man nicht auf mich gewartet, daß ich es feststellte, aber das ist ein vollkommenes Musikstück! […] Laß dir sagen, ich neige mehr und mehr zu dem Eingeständnis, daß es schon etwas Eigentümliches ist um eure Musik. Eine Bekundung höchster Tatkraft – nichts weniger als abstrakt, aber gegenstandslos, einer Tatkraft im Reinen, im klaren Äther – wo kommt denn so was im Weltall noch einmal vor! Wir Deutschen haben aus der Philosophie die Redewendung ‹an sich› übernommen und brauchen sie alle Tage, ohne uns viel Metaphysik dabei zu denken. Aber hier hast du’s, solche Musik ist die Tatkraft an sich, die Tatkraft selbst, aber nicht als Idee, sondern in ihrer Wirklichkeit. Ich gebe dir zu bedenken, daß das beinahe die Definition Gottes ist. Imitatio Dei – mich wundert, daß es nicht verboten ist. Vielleicht ist es verboten.»
Mein größtes Werk
Im gewaltigen, alle Dimensionen sprengenden Spätwerk der ‹Missa Solemnis op. 123› laufen alle diese Fäden zusammen – mehr noch als in der berühmten und populären ‹9. Sinfonie›.
Die Sprache ist hier die der Liturgie, die Botschaft die des Leidens, der Überwindung, der Hoffnung, die Musik voller Rätsel und die üblichen Regeln kirchlicher Musik außer Acht lassend. Beethoven hat sie in ihrer Gänze nie zu hören bekommen – er hätte sie ja auch nicht mehr hören können! In einem denkwürdigen Konzert vom Mai 1824 kamen in Wien drei Sätze ‹Kyrie›, ‹Agnus Dei› und ‹Sanctus› daraus zur Aufführung, aber nicht als Messe, sondern als ‹Drei Hymnen›, zudem auf Deutsch gesungen – was der Borniertheit des österreichischen Katholizismus zu danken war. Im selben Konzert wurde die ältere Ouvertüre ‹Die Weihe des Hauses› gegeben, daraufhin erfolgte die Uraufführung der ‹9. Sinfonie›. Beethoven war anwesend, hörte nichts, sah den eklatanten Beifall des Publikums.
Zu wenig wird von der Bedeutung der Beziehung gesprochen, aufgrund welcher die ‹Missa› entstanden ist. Erzherzog Rudolph von Österreich sollte als Erzbischof von Olmütz und Mähren inthronisiert und zu diesem Anlass eine Große Messe bei Beethoven in Auftrag gegeben werden. Dieser Erzherzog war seit 1804 Beethovens Klavierschüler. Ab 1808 hatte er ihm, zusammen mit zwei Wiener Aristokraten, eine bedingungslose Grundrente ausgesetzt. Wichtigste Werke sind ihm gewidmet, was für einen hohen Freundschaftsgrad spricht – etwa die Sonate ‹Les Adieux›, die Hammerklavier-Sonate, die Sonate op. 111, die ‹Fidelio›-Partitur, das nach ihm benannte Trio, das vierte und das fünfte Klavierkonzert, die der Erzherzog durchaus selber zu spielen vermochte, mitsamt der Kadenzen, die heute noch vorgetragen werden. Und nun die ‹Missa Solemnis›. Beethoven bezeichnet sie als «das größte Werk, welches ich bisher geschrieben». Wie wir seit 2019 wissen, liegt ihm eine langjährige Beschäftigung mit Konzilen, Gottesbildern, Jesus-Klärungen zugrunde. «Sokrates und Jesus waren mir Muster», heißt es im Konversationsheft. Und im Tagebuch «Ergebenheit, innigste Ergebenheit in dein Schicksal, nur dies kann dir die Opfer zu dem Dienstgeschäft geben – oh harter Kampf! – alles mußt du finden, was dein seligster Wunsch gewährt, so mußt du es doch abtrotzen, absolut die stete Gesinnung beobachten […] Gott, gib mir die Kraft, mich zu besiegen, mich darf ja nichts an das Leben fesseln.» Kant hat er darin auf sein eigenes Maß ausgeweitet: «Die Zusage der Gnade Gott-Vaters über mir, und das moralische Vorbild des Menschen Jesus in mir lassen mich an einen Gott glauben.»
Musikalisch geschehen unerhörte Dinge. Arhythmien und Spannungen prägen den ersten, den Kyrie-Satz. Der Gloria-Satz macht einen Abgrund deutlich zwischen Gott und Mensch. Fugen, Doppelfugen prägen das Credo, das Wunder der Auferstehung vollzieht sich in altertümlich lydischer Tonart, darin Palestrina folgend. Eine sinfonische Musik begleitet die Transsubstantiation von Brot und Wein, ein innigstes Geigensolo die Herabkunft des Geistes; mitten in das Finale hämmert eine befremdlich kriegerische Pauken- und Trompetenmusik – das Dona Nobis Pacem steht in Gefahr, bleibt mehr Verheißung als Gegenwart – die ‹Missa› erscheint als ein Dokument von Selbstverstrickung und Zukunftsglauben. Vielleicht ist sie dadurch Beethovens persönlichstes Werk. Natürlich war sie noch längst nicht vollendet, als schließlich die Feiern, für die sie bestellt war, stattfanden. Die wahrscheinlich erste öffentliche Gesamtaufführung der ‹Missa› erfolgte im Mai 1839 in Dresden, also erst zwölf Jahre nach Beethovens Tod, und nur vereinzelt kam es im Verlauf des 19. Jahrhunderts zu weiteren Wiedergaben. Ausschlaggebend, so im Brief vom 16. September 1824, war für ihn «sowohl bei den Singenden als Zuhörenden religiöse Gefühle zu erwecken und dauernd zu machen».
So steht Ludwig van Beethoven uns 250 Jahre nach seiner Geburt für dreierlei: für einen prometheischen Freiheitswillen – für eine Selbsterziehung zu christlicher Demut – für Kampf um Wahrheit im inneren wie im äußeren Leben.
Richard Wagner 1870: «Nicht also das Werk Beethovens, sondern jene in ihm enthaltene unerhörte künstlerische Tat des Musikers haben wir hier als den Höhepunkt der Entfaltung seines Genius festzuhalten.»
Der Autor spricht am 16. Dezember im Scala Basel zu Ludwig van Beethoven. (Publikum limitiert)
Literatur zum Artikel
Richard Wagner, Gesammelte Schriften, Beethoven. Leipzig 1870.
Rudolf Steiner, Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen. GA 102, Dornach 1974.
Friedrich Oberkogler, Ein Weg zu Beethoven. Freiburg 1970.
Thomas Mann, Dr. Faustus. Frankfurt 1980.
Meinrad Walter, Beethoven, Missa Solemnis. Leinfelden-Echterdingen 2019.