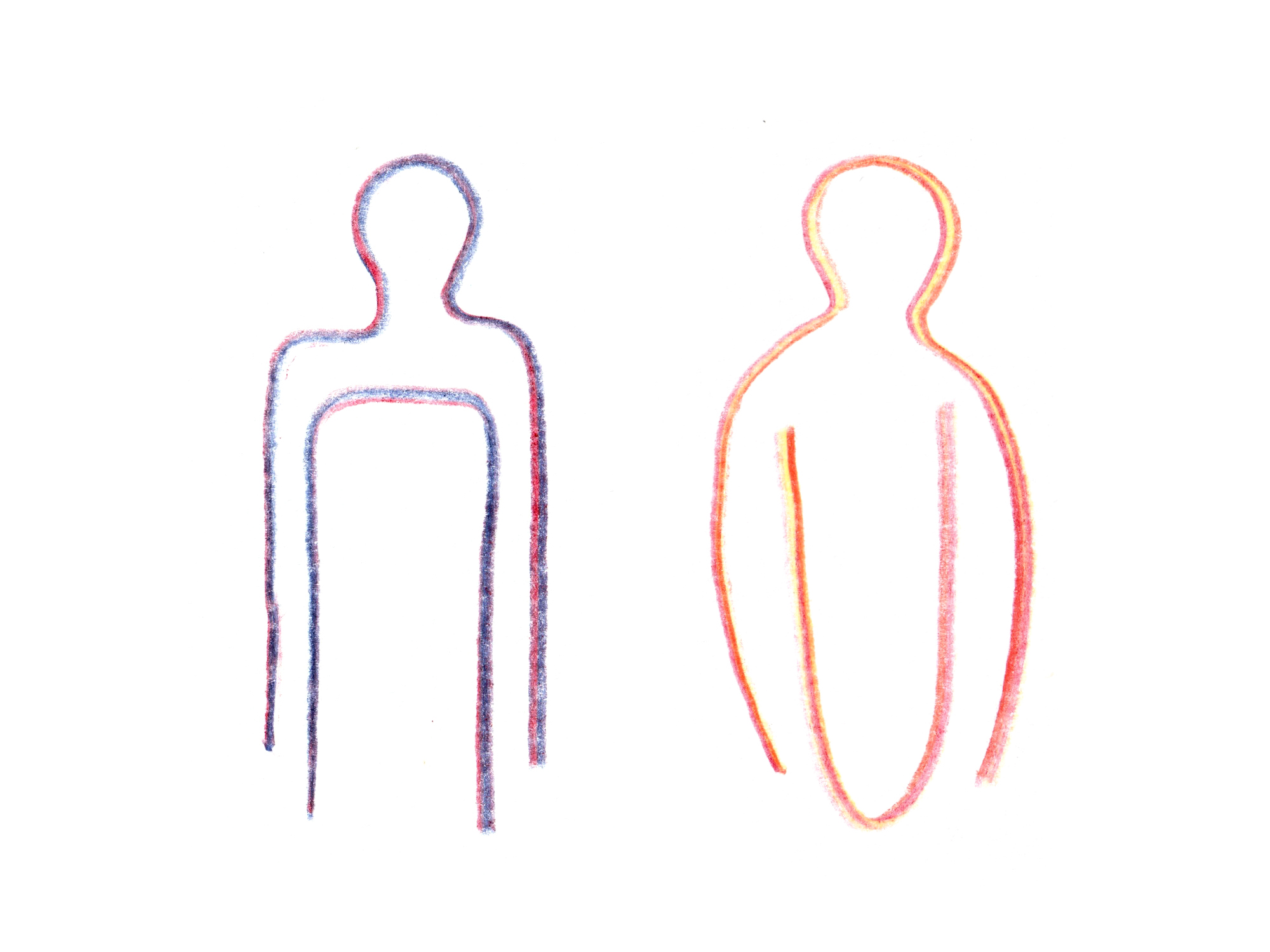Seit 2013 gibt es die Diagnose ‹Genderdysphorie› für Menschen, die ihre geschlechtliche Identität anders erleben, als sie bei der Geburt zugeschrieben wurde. Die Möglichkeiten zur Veränderung sind groß. Das wirft Fragen für den medizinischen Umgang mit den Betroffenen auf, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Ärztinnen und Ärzte sind mehr denn je auf die Schulung ihrer Wahrnehmung und die Begegnung von Mensch zu Mensch angewiesen.
Wie empfinden Sie sich gerade jetzt, als Mann oder als Frau? Wie würde sich das andere Geschlecht für Sie anfühlen, wenn Sie in die Rolle schlüpften? Wenn ich mir bewusst mache, wie ich gekleidet bin, und mir vorstelle, ich wäre statt eines Manns eine Frau, dann ändert sich einiges in mir. Auch wenn sich vieles verändert hat in unserer Kultur, gibt es eine klassische, vielleicht stereotype Geschlechterwahrnehmung und Rollenverteilung zwischen Mann und Frau. Für manche ist das vollkommen passend. Aber es gibt ebenso Menschen, für die das gar nicht passt. Etwa 1200 von 100 000 Menschen, also 1,2 Prozent, fühlen sich unwohl mit ihrer Geschlechterzuordnung und 3 von 100 000 Frauen und 8 von 100 000 Männern fühlen sich so unwohl in dem Körper, der ihnen durch Geburt geschenkt wurde, dass sie eine operative Änderung anstreben.1
In der Endokrinologie wird besonders deutlich, was zunehmend kulturelle Gegenwart wird: Der Körper bringt ein Spektrum mit. Ein Embryo im Mutterleib, auf den weniger Testosteron einwirkt, kann das männliche Geschlechtsorgan nicht voll ausbilden. Die Ausbildung unseres geschlechtsabhängigen Empfindens und Verhaltens hängt sowohl vom Inneren als auch von unserer Umgebung ab und gestaltet sich daher seit jeher mannigfaltig. Es gibt ein Spektrum von Geschlechtern und nicht nur zwei Pole, wie sie die historisch gewachsene Rollenverteilung in den meisten Ländern vorgibt.
Sich selbst hervorbringen können
‹Gender› ist verwandt mit ‹genesis›. Es geht um ‹Hervorbringen›. In uns ist etwas, das hervorbringt und das auf die Welt kommt und sich mit einem Körper verbindet. Dieses schöpferische Wesen muss das Gefühl haben, dass es mit dem Körper zusammenpasst. Oder es muss lernen, mit dem, was ist, umzugehen. Wie gehen wir mit ‹Gender› um und wie lernen wir, mit unserem eigenen Geschlecht umzugehen? Bereits 1905 schrieb der deutsche Sexualforscher Magnus Hirschfeld über Geschlechterübergänge und 1910 über Transvestie. Das Thema ‹Geschlechtlichkeit› in der Psychologie wurde durch Madison Bentley in den USA weiter erforscht. Simone de Beauvoir, die Meilensteine für den Feminismus gesetzt hat, schrieb in ihrem Hauptwerk ‹Das andere Geschlecht›, dass niemand als Frau geboren werde, sondern man zu ihr gemacht wird. Rudolf Steiner hatte bereits 1894 in ‹Die Philosophie der Freiheit› geschrieben: «Der Mann sieht im Weibe, das Weibe im Manne fast immer zu viel von dem allgemeinen Charakter des anderen Geschlechtes und zu wenig von dem Individuellen.» (Kapitel XIV: Individualität und Gattung). Im selben Kapitel weist er auf die «menschenunwürdige» Behandlung der Frauen «als Gattungswesen» hin und konstatiert einen dringenden sozialen Veränderungsbedarf. Heute sieht die Gleichstellung schon besser aus, obwohl es viele Situationen gibt, in denen wir uns in Geschlechterklischees bewegen. Trotzdem hält sich ein weltweites Ungleichgewicht, zum Beispiel bei der ungleichen Bezahlung (Gender Pay Gap) von Männern und Frauen in gleichen Verantwortungspositionen. In sehr konservativen Gesellschaften ist dieser Abstand besonders groß. Doch es ist nicht wertvoll, die dahinterliegenden Einstellungen schnell zu verurteilen. Aus ihrer Perspektive meinen solche Gesellschaften, Frauen vor einer männlichen Welt schützen zu müssen, und es gibt auch Frauen, die ihrerseits diese Art von ‹Frausein› suchen. Wir sind angefragt, anstatt zu urteilen, unsere Perspektive auf ‹Gender› zu differenzieren.
Auf der ganzen Welt gibt es und gab es seit Jahrhunderten Subkulturen von Menschen in diversen Gender-Rollen. Zum Beispiel die Hijra in Bangladesch: Männer, die als Frauen leben. Oder in Selca, Albanien, die Burrnesha (‹eingeschworene Jungfrauen›): Frauen, die die Männerrolle in einer Familie übernahmen, wenn ein Mann sonst fehlte.
John Money in den USA war der erste Psychologe, der zu ‹Gender› experimentierte. Er beriet die Familie Reimer nach einer missglückten Beschneidung, ihren verstümmelten Sohn durch Erziehung zu einem Mädchen zu machen. Später publizierte er dazu, dass es gelungen sei, und beschrieb ‹Gender› deshalb als soziales Konstrukt. Dieses Beispiel von psychologischer Manipulation einer ganzen Familie, die das Kind und wie es sich selbst zeigte nicht weiter wahrgenommen hat, hatte furchtbare Folgen. Als diese ‹Tochter› in der Pubertät schwer depressiv wurde und sich weigerte, weiterhin den Psychologen Money aufzusuchen, eröffneten die Eltern ‹ihr› die Wahrheit und ‹sie› wollte sofort wieder ein Junge werden, was auch geschah. Die psychische Belastung blieb aber immens. Der Zwillingsbruder wurde schizophren und beging früh Suizid. Und der wieder zum Jungen gewordene Sohn hat, obwohl er heiratete und Kinder adoptierte, so sehr gelitten, dass auch er sich mit 32 Jahren das Leben nahm.
Inzwischen wissen wir sehr viel mehr über äußere und innere Prägung. Es gibt zahlreiche Studien zur Kindes- und Geschlechtsentwicklung, zum Beispiel wie sich die hormonellen Einflüsse in der Embryonalzeit nicht nur auf die biologische Geschlechtsentwicklung auswirken, sondern auch auf das spätere Verhalten des Kindes.2 In der Forschung mit Spielzeugen gibt es einige Untersuchungen, die zeigen, dass es geschlechtsspezifische Präferenzen gibt, sowohl nach den Farben Pink und Blau als auch nach Orientierung entweder auf das Ästhetische und Beziehungsmäßige bei Mädchen oder auf das Mechanische bei Jungen.3 Äußerst interessant ist auch, dass das Interesse am Geschlechtswechsel bei Männern deutlich höher ist als bei Frauen.4 Trotz der Tatsache, dass Frauen weiterhin in vielen Bereichen schlechtergestellt sind! Der Dokumentarfilm ‹Mädchenseele› zeigt die Entwicklung eines Kindes, das sehr früh zu einem Mädchen werden will und auch Mädchen-typisch auftritt. Sein größter Wunsch ist bereits als Kind, eine Geschlechtsoperation zu erhalten.5 Spätestens dann wird es kompliziert für die Erwachsenen, die das Kind als Eltern oder medizinisch-therapeutisch begleiten.
Natürlich wollen wir für ein Verständnis der Situation die Ursachen für diese zu differenzierenden Phänomene kennen. 2022 wurde eine Studie mit über 2500 Geschwistern von Transgender-Menschen, darunter 67 ein- und zweieiige Zwillingspaare, vorgelegt. Keines der gleichgeschlechtlichen Zwillingsgeschwister war transgender, doch weit überdurchschnittlich viele der gegengeschlechtlichen Zwillingsgeschwister.6 Das spricht gegen eine genetische Veranlagung, könnte aber mit einer biologischen Prägung oder Feldprägung durch ein lebendes oder in utero verstorbenes gegengeschlechtliches Zwillingsgeschwister vereinbar sein.
Herausfordernd in der Beratung ist das Wissen, dass 6 bis 7 Prozent derjenigen, die eine hormonelle und operative Geschlechtsangleichung vornehmen, später doch in ihr ursprüngliches Geschlecht zurückkehren.7
Was sich in jedem Fall schon in Befragungen gezeigt hat, ist, dass es Kindern, die bei transidenten Eltern aufwachsen, nicht anders geht als anderen Kindern in der Hinsicht, dass es ihnen gut geht, wenn die Beziehung der Eltern und die Kommunikation in der Familie gut sind.8

Der Anfang der Diagnose
Obwohl es immer Menschen gab, die jenseits der bis heute entstandenen Mann-Frau-Identifikation lebten oder sich mit dem zugeschriebenen oder biologischen Geschlecht unwohl fühlten, gab es bis 2013 keine offizielle Diagnose als ICD-Code dafür. So ist die Beschreibung ‹Genderdysphorie› noch jung und wurde zuvor auch aufgrund mangelnder Begriffe kaum attestiert. Die vier Ebenen des Geschlechts, an denen wir uns orientieren können, sind: nach Physis (Chromosomen, Gonaden, Genitalien, Habitus), im persönlichen Ausdruck (Bewegung, Spiel, Kunst, Bekleidung), nach Anziehung (In wen verliebe ich mich?) und nach Identität (Welchem Geschlecht fühle ich mich zugehörig?). (Siehe Darstellung oben)
Der erste praktische Fall, den ich betreute, war eine jugendliche Patientin, die wegen ständigen Bauchwehs 2014 zu uns in die Klinik kam. Wir haben bei ihr vieles versucht, aber nichts half, bis wir in einem Gespräch darauf kamen, dass das Mädchen sich abgesehen von seiner körperlichen Zuordnung zum weiblichen Geschlecht in seinem Verhalten, seinen Beziehungen und seiner Identifikation eher als Junge empfand. Sie schrieb sogar im Internet Geschichten für viele Lesende, aber online war sie unter einem männlichen Pseudonym tätig. Sie offenbarte, dass sie gern dieser Junge wäre, unter dessen Namen sie schrieb. Ich bot an, dass wir das in Gesprächen erkunden könnten, und fragte, ob es gut für sie wäre, wenn ich ‹sie› als ‹er› und mit seinem Pseudonym adressierte. So geschah es und unser Team erweiterte diesen Versuch auf alle auf der Station, die mit ihm zu tun hatten, in gemeinsamem Einverständnis. So wurde er auf der Station fortan als Junge behandelt. Was für mich interessant war an unseren folgenden Gesprächen, war die auffällig veränderte Präsenz, die ich erlebte. Bereits zuvor war er immer sehr geistreich im Gespräch gewesen, doch unter den neuen Voraussetzungen spürte ich eine wirkliche Begegnung von Ich zu Ich. Das Nebulöse, das sich zuvor immer wieder vorgeschoben hatte, war verschwunden – jetzt war da ein Gegenüber. Alle Therapeutinnen und Therapeuten, die mit ihm arbeiteten, bestätigten diesen Eindruck. Er hatte jedoch große Angst, es seiner Mutter mitzuteilen, und tatsächlich reagierte sie auch zuerst ganz abwehrend und überfordert: Das geht nicht; das kannst du nicht machen! Du kannst so nicht zur Schule gehen. Was wird dein Opa dazu sagen? Und so weiter. Er musste als Mädchen in die Familie zurückgehen und die Bauchschmerzen waren wieder da. Später konnte er die Schule wechseln und wechselte sofort zu einem männlichen Namen, was die neue Schule akzeptierte. Ab dann blühte er auf und die Mutter berichtete mir, welch schöne Abende sie miteinander verbrachten und wie geistreich dieser junge Mensch sei.
Die Wahrnehmung jedes einzelnen Falls zählt
Ärzte und Ärztinnen sind mit solchen schwer zu durchschauenden Situationen konfrontiert, wenn Kinder mit ihren Eltern kommen und sagen, dass sie sich im falschen Körper fühlen. Heute bin ich kaum noch in der Rolle, dass ich zentral bin für das Herausfinden der Identifikation. Meistens ist das Bild bereits vollkommen ‹klar›, wenn eine Sprechstunde aufgesucht wird. In bestimmten Fällen ist es für alle Beteiligten so offensichtlich, dass es sich unrichtig anfühlt, keine hormonellen Pubertätsblocker zu verschreiben. In anderen Fällen passen die Symptome nicht alle zusammen und es werden Wege gesucht, um Unstimmigkeiten zu klären. In allen Situationen geht es vor allem darum, Zeit und inneren Raum zu geben. Die Abklärung jedes Falls ist deshalb so fordernd für die Medizinerinnen und Mediziner, weil sie (zusammen mit einem psychologischen Team) eine Entscheidung treffen, die in jedem Fall irreversible Konsequenzen hat. Die Behandlung mit geschlechtsverändernden Hormonen bringt ebenso wie die natürliche Pubertät irreversible Veränderungen für die Betroffenen mit sich. Die Behandlung mit Pubertätsblockern ist auch nicht folgenlos. Die Hormonblocker sind eine fantastische Erfindung aus der Brustkrebstherapie und ein Segen, wenn man mit einem Kind konfrontiert ist, das bereits mit vier Jahren in die Pubertät kommt (Pubertas praecox). Sie können auch als kurzzeitige Anwendung sehr hilfreich sein für Jugendliche, die in einem aufwühlenden Orientierungsprozess stehen. Durch die monatliche Spritze wird die Hypophyse durchgehend so stimuliert, dass das Einsetzen der Pubertät angehalten wird. Für Kinder, die sich in dieser Situation wiederfinden, in der sie erleben, dass etwas mit ihrem Körper passiert, das sie auf keinen Fall möchten, ist das eine große Erleichterung, die ihnen etwas Zeit verschafft, zu entscheiden. Wenn die Gabe der Hormonblocker beendet wird, setzt die Pubertät wieder ein. Natürlich kann die Zeit, die verstrichen ist, nicht wieder eingeholt werden. Wenn die Hormonblocker jedoch über zu lange Zeit verabreicht werden, nimmt die Knochendichte der Behandelten ab, denn Östrogen und Testosteron werden in der Pubertät für den Knochenaufbau benötigt. Ob das klinisch signifikant ist, ist zu bezweifeln, denn Eunuchen leben sogar länger als andere Männer.
Trotz dieser komplexen Abwägung von Risiken ist die Herausforderung viel größer, wenn über die Gabe von Hormonen entschieden werden muss, die eine Änderung der Geschlechtsausprägung bewirken, die sich nicht völlig widerrufen lässt. Einer meiner aktuelleren Fälle war so: Ein junger Mensch kommt in meine Sprechstunde, der bis dahin als Mädchen galt und an Anorexie erkrankt war. In der psychotherapeutischen Behandlung der Essstörung wird deutlich, dass sich dieser junge Mensch als Junge fühlt und die Anorexie ein Weg war, die Pubertät zu verhindern. Die Eltern und die Schulumgebung wissen es bereits und haben sich damit arrangiert. Jetzt möchte dieser junge Mensch hormonell behandelt werden, zuerst mit Pubertätsblockern und dann bald mit Testosteron. In solchen Fällen bleibt mir nur meine eigene Wahrnehmung. Ich muss auf meinen Eindruck von diesem Menschen vertrauen. Zur Unterstützung dieses Prozesses hole ich immer zwei weitere Gutachten ein. Diese Gutachten stellen eine Belastung für die Patientinnen und Patienten dar, aber da die Ärztin oder der Arzt nur mit dem eigenen Urteil an dieser folgenreichen Entscheidung arbeiten kann, finde ich es wichtig. In diesem Fall kamen die beiden Gutachten zum gleichen Urteil wie ich: Die Gabe von Testosteron ist vertretbar und im Sinne dieses Menschen. Selbstverständlich ist die Aufklärung über die irreversiblen Folgen der Hormongabe im Vorfeld ausführlich zu leisten. Die Therapie beginnt mit einer kleinen Dosis, die gesteigert wird. Nach einigen Monaten zeigte sich bereits, dass es dem Patienten und allen Beteiligten sehr gut ging mit dieser Entscheidung. Jetzt, fünf Jahre später, erscheint es immer noch als richtig.
Es ist wunderbar, wenn dieser Entscheidungsfindungsprozess so gelingt. Eine weitere Seite der aktuellen Situation zeigt sich, wenn solch ein Mensch in die Schulklasse zurückkehrt und dort mit viel Charisma und Energie auftritt. Er zieht mitunter Aufmerksamkeit auf sich und andere Jugendliche fragen sich, ob sie das nicht auch in sich haben. Sie gehen ins Internet und haben Zugang zu sehr vielen Berichten und können sich das – gerade als Pubertierende mit einem besonders beeindruckbaren Gehirn – so einverleiben, dass sie sich selbst und andere überzeugen können, dass sie auch transgender sind. Damit stehen Ärztinnen und Ärzte, Therapeutinnen und Therapeuten heute vor umso größeren Herausforderungen. Es gibt viele Situationen, in denen ich feststelle, dass ich diesen Umwandlungsprozess nicht vertreten kann. Dann muss ich den Betroffenen sagen, dass sie, wenn sie diesen Weg gehen wollen, eine andere medizinische Begleitung brauchen, oder, wenn sie sich auch unsicher sind, wir uns zusammen Zeit nehmen können, um die Situation zu explorieren, aber dass ich nicht bereit bin, eine hormonelle Behandlung einzuleiten. Wiederum: Alles, worauf wir uns verlassen können, ist die Wahrnehmung des Menschen vor uns, die Wahrnehmung derer, die ihn umgeben, und unsere eigene Intuition.
Beziehungen sind einzigartig
Es gibt viele Beispiele für die große Bandbreite der Geschlechter und wie vielfältig wir leben können. Ich erzähle den Kindern und Jugendlichen in der Beratung viele Beispiele, damit sie die sehr verschiedenen Möglichkeiten sehen, die mit und ohne eine Geschlechtsangleichung gegeben sind, und nicht zu früh in eine Entscheidung stürzen. Sexualität ist etwas sehr Intimes und sie ist nicht gleich mit jedem Partner, jeder Partnerin. Es könnte sich deshalb auch lohnen zu schauen, wer mein Partner, meine Partnerin sein kann und sein wird und wie sich die gemeinsame Sexualität gestaltet. Auch darauf verweise ich als Arzt. In der Tierwelt gibt es so zahlreiche Beispiele für die verschiedensten Partnerschafts-, Sexualitäts- und Familienformen; beim Menschen ist es hochindividuell.
Die vier Ebenen des Geschlechts, die wir einschätzen können, ergeben ein vielfältiges Spektrum, in dem wir uns als Menschen bewegen, und es ist unsere Aufgabe als Ärztinnen, Therapeuten, Pädagoginnen und Psychologen, herauszufinden, was das für jeden einzelnen Menschen, immer neu und auch im Umgang miteinander, bedeutet.
Weiterführende Literaturhinweise
Livia Prüll, Trans* im Glück – Geschlechtsangleichung als Chance; Autobiographie, Medizingeschichte, Medizinethik. Vandenhoeck & Ruprecht, 1. Auflage 2016.
Udo Rauchfleisch, Transsexualismus – Genderdysphorie – Geschlechtsinkongruenz – Transidentität; Der schwierige Weg zur Entpathologisierung. Vandenhoeck & Ruprecht, 1. Auflage 2019.
Alexander Naß u. a. (Hrsg.), Geschlechtliche Vielfalt (er)leben: Trans*- und Intergeschlechtlichkeit in Kindheit, Adoleszenz und jungem Erwachsenenalter. Buchreihe: Angewandte Sexualwissenschaft, Vol. 8, Psychosozial-Verlag, 2016.
Fußnoten
- Kenneth J. Zucker, Epidemiology of gender dysphoria and transgender identity. In: Sexual Health 14(5), August 2017, S. 404–411.
- Paola Escudera et al., Sex-related preferences for real and doll faces versus real and toy objects in young infants and adults. In: Journal of Experimental Child Psychology, Oktober 2013.
- Liquan Liu et al., Factors affecting infant toy preferences: Age, gender, experience, motor development, and parental attitude. In: Infancy, Band 25, Ausgabe 5. Juni 2020, S. 593–617.
- Siehe Fußnote 1, ebd.
- Anne Scheschonk, Mädchenseele. Dokumentarfilm 2015/17.
- Georgios Karamanis et al., Gender dysphoria in twins: a register-based population study. In: Scientific Reports, August 2022.
- Siehe Fußnote 1, ebd.
- Alexander Naß u. a. (Hrsg.), Geschlechtliche Vielfalt (er)leben: Trans*- und Intergeschlechtlichkeit in Kindheit, Adoleszenz und jungem Erwachsenenalter. Buchreihe: Angewandte Sexualwissenschaft, Psychosozial-Verlag, 2016.