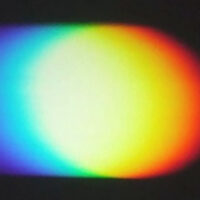Immanuel Kant feiert seinen 300. Geburtstag – ein guter Grund, mit Eckart Förster dem Denken und Erkennen des Begründers der modernen Philosophie zu folgen. Es ist ein beschwerlicher Weg, der am Ziel einen Aussichtspunkt liefert: zu verstehen, wie aus Meinung Wissen und aus Kenntnis Erkenntnis wird.
Diskussionen über Kants Erkenntnistheorie gehen gewöhnlich von seiner ‹Kritik der reinen Vernunft› (1781) aus, und aus gutem Grund. Doch in den Jahren vor ihrer Veröffentlichung, der sogenannten vorkritischen Periode, machte Kant eine Reihe von Entdeckungen, die die Grundlage für seine reife Philosophie bilden. Es sind vor allem drei Erkenntnisse, ohne die die ‹Kritik› selbst nicht möglich gewesen wäre. Die erste betrifft den Unterschied zwischen logischer und realer Möglichkeit, die zweite die Unterschiede zwischen unseren Erkenntnisstämmen, die dritte die Vernunft als Quelle von Illusionen. Ich werde mit den ersten beiden beginnen und die dritte Einsicht am Ende dieses Aufsatzes diskutieren.
Formale und reale Möglichkeit
Schon früh erkannte Kant, dass ein Beweis für die Existenz Gottes à la Descartes nicht möglich ist. Descartes hatte argumentiert, dass der Begriff Gottes als des vollkommensten Wesens die Existenz einschließen müsse, denn sonst wäre immer noch ein vollkommeneres Wesen möglich, d. h. ein Gott, der tatsächlich existiert. Kant wandte ein: Auch wenn der Begriff von Gott der Begriff eines Wesens ist, das alle Realitäten enthält und somit vollkommen ist, ist die Existenz keine Realität (kein Prädikat oder eine Bestimmung eines Gegenstandes). Wenn wir den Gedanken von einem tatsächlichen Objekt mit dem Gedanken an dasselbe Objekt als mögliches, aber noch nicht verwirklichtes Objekt vergleichen, stellen wir fest, dass beide Gedanken dieselbe Menge von Prädikaten verwenden. «Das Dasein kann daher selbst kein Prädicat sein»1, es kann also nicht in dem bloßen Begriff von etwas, auch nicht in dem von Gott, enthalten sein.
Dennoch hielt Kant zu dieser Zeit einen Beweis für die Existenz Gottes für möglich, aber nur indirekt und in Bezug auf einen anderen Begriff, nämlich den der Möglichkeit. Zu urteilen, dass etwas möglich sei, bedeutet zu sagen, dass die Vorstellungen, die das Urteil ausmachen, einander nicht widersprechen. Dies ist die formale Bedingung der Möglichkeit. Aber es gibt auch eine materielle Bedingung: Bei jedem Vergleich muss das, was verglichen werden soll, gegeben sein. Wenn es nichts zu vergleichen gibt, kann es keinen Vergleich und damit keine Möglichkeit geben. Das bedeutet, erklärt Kant, dass nichts als möglich gedacht werden kann, wenn nicht das, was in jeder möglichen Vorstellung real ist, existiert. Und zwar muss es mit Notwendigkeit existieren, denn ohne dies gäbe es keine Möglichkeit, d. h., Möglichkeit wäre selbst unmöglich, was ohne Selbstwiderspruch nicht gedacht werden kann. Folglich setzt die Möglichkeit aller Dinge ein notwendiges Dasein voraus.
Schon bald erkannte Kant jedoch, dass sein Argument insgeheim voraussetzt, dass es Denken gibt. Die angebliche Notwendigkeit aller möglichen Realitäten ist lediglich eine hypothetische Notwendigkeit und setzt voraus, dass Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. Dies ist aber selbst nicht notwendig. Wie Kant später in der ‹Kritik der reinen Vernunft› schrieb: «Ich kann mir nicht den geringsten Begriff von einem Ding machen, welches, wenn es mit allen seinen Prädikaten aufgehoben würde, einen Widerspruch zurückließe» (KrV, A 595 f.)2.

So kam Kant zu der Überzeugung, dass allen theoretischen Beweisen für die Existenz Gottes eine Verwechslung der Notwendigkeit des Denkens mit der Notwendigkeit der Dinge zugrunde liegt. Wenn dem aber so ist, muss man nicht nur eine formale und eine materielle Bedingung der begrifflichen Möglichkeit unterscheiden, sondern auch eine formale und eine materielle Komponente in Bezug auf die Möglichkeit der Dinge. Mit anderen Worten, es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen dem Denken eines Gegenstandes und dem Erkennen desselben. Um einen Gegenstand zu denken, muss sein Begriff widerspruchsfrei sein. Um ihn aber zu erkennen, muss man wissen, dass das Objekt, das man denkt, auch objektive Realität hat oder «wirklich möglich» ist. Andernfalls hat man zwar etwas gedacht, «aber durch dieses Denken nichts erkannt, sondern bloß mit Vorstellungen gespielt» (KrV, A 155). Ist der Begriff ein empirischer Begriff, so zeigt die Erfahrung, dass sein Gegenstand «wirklich möglich» ist, weil er in der Wahrnehmung gegeben ist. Handelt es sich jedoch um einen apriorischen Begriff, wie es in der Philosophie der Fall ist, muss man zeigen können, wie sein Gegenstand möglich ist, um die objektive Realität seines Begriffs zu kennen. Ist eine solche Apriori-Erkenntnis möglich? Kann die Philosophie die objektive Realität ihrer apriorischen Begriffe erweisen? Diese Frage allgemein zu beantworten, ist eine der Hauptaufgaben von Kants ‹Kritik der reinen Vernunft›.
Zwei Stämme der menschlichen Erkenntnis
Das zweite Ergebnis der vorkritischen Schriften Kants, das für das Verständnis der Erkenntnistheorie der ‹Kritik› wesentlich ist, betrifft den fundamentalen Unterschied zwischen Denken und Wahrnehmen. Sowohl die Rationalisten wie die Empiristen unter seinen Vorgängern nahmen einen bloß quantitativen oder graduellen Unterschied zwischen beiden an. Zunächst teilte Kant diese Auffassung; ab 1768 glaubte er jedoch, deren Falschheit zeigen zu können. Auslöser dieser Überzeugung war seine Erörterung «inkongruenter Gegenstücke», d. h. solcher Objekte, die in Bezug auf Größe, Proportion und Lage ihrer Teile vollkommen gleich sind, aber dennoch keine gemeinsamen Grenzen haben können und daher nicht identisch sind – zum Beispiel die beiden menschlichen Hände: «Die rechte Hand ist der linken ähnlich und gleich, und wenn man bloß auf eine derselben allein sieht, auf die Proportion und Lage der Theile unter einander und auf die Größe des Ganzen, so muß eine vollständige Beschreibung der einen in allen Stücken auch von der andern gelten.»3 Obwohl begrifflich ununterscheidbar, sind linke und rechte Hand (wie alle inkongruenten Gegenstücke) dennoch sinnlich unterscheidbar und real unterschieden.
Daraus scheint zu folgen, dass sich Denken und Wahrnehmen nicht nur graduell voneinander unterscheiden können, sondern dass sie im Gegenteil als zwei grundsätzlich verschiedene Erkenntnisquellen mit ihren je eigenen Bedingungen und Grenzen betrachtet werden müssen. Sinnliche Gegenstände sind folglich keine «Vernunftgegenstände» (Dinge an sich), sondern deren «Erscheinungen». Für die menschliche Erkenntnis sind beide «Stämme» der Erkenntnis gleichermaßen notwendig, denn durch Denken werden keine Objekte gegeben, durch Wahrnehmen keine Dinge an sich erkannt.
Die Kritik der reinen Vernunft
In der ‹Kritik der reinen Vernunft› betrachtet Kant zunächst die Sinnlichkeit und den Verstand getrennt voneinander, um dann ihr Zusammenwirken in der Erkenntnis zu untersuchen. «Die Fähigkeit (Rezeptivität), Vorstellungen durch die Art, wie wir von Gegenständen affiziert werden, zu bekommen, heißt Sinnlichkeit.» (KrV, A 19). Die Wirkungen dieses Prozesses sind folglich «Modificationen unseres Zustands», d. h. Vorstellungen «in uns». Was gegeben ist, sind nicht Objekte, sondern subjektive Empfindungen. Wie ist es dann aber möglich, jemals Kenntnis von Objekten außerhalb von uns zu haben?
Kants erster Schritt zur Lösung dieses Problems ist die Erkenntnis, dass der Begriff des Raumes nicht von äußerer Erfahrung abstrahiert sein kann. Denn wie sollte das geschehen? Zunächst hätten wir eine Folge von Empfindungen im inneren Sinn, eine nach der anderen. Um daraus die Vorstellung des Raumes zu gewinnen, müsste ich in der Lage sein, von ihnen die Vorstellungen der Koexistenz verschiedener Orte und deren Gleichzeitigkeit zu abstrahieren. Nun sind zwei Dinge, A und B, gleichzeitig, wenn die Wahrnehmungen von A und B wechselseitig verlaufen und aufeinanderfolgen können. Im inneren Sinn aber ist alles sukzessiv, und jede neue Vorstellung ist später als die vorhergehende. Im inneren Sinn allein ist es unmöglich, eine Mannigfaltigkeit als simultan und damit als von mir verschieden darzustellen. Eine Unterscheidung zwischen einer Folge von Vorstellungen in mir und etwas Bleibendem außer mir, zwischen einer subjektiven Folge von Wahrnehmungen und einer objektiven Ordnung koexistierender Elemente, kann also nicht allein auf der Grundlage des inneren Sinns getroffen werden: Die apriorische Vorstellung vom Raum macht die Erfahrung der Gleichzeitigkeit erst möglich und kann daher nicht von ihr abstrahiert werden.
Nach Kant bedeutet dies, dass der Raum eine Form der Anschauung ist, die es mir ermöglicht, etwas als nebeneinander und von mir verschieden vorzustellen. Zugleich schränkt sie mich ein: Ich kann etwas nur als von mir verschieden vorstellen, indem ich es als an einem anderen Ort befindlich denke. Allerdings verweist der Raum als Form der äußeren Anschauung selbst noch nicht auf von mir Unterschiedenes. Dafür sind Begriffe und Urteile erforderlich, die nur der Verstand liefern kann. «Wir können aber alle Handlungen des Verstandes auf Urteile zurückführen, so daß der Verstand überhaupt als ein Vermögen zu urteilen vorgestellt werden kann.» (KrV A 69) Da der Verstand keine eigenen Anschauungen erzeugt, sondern für seine Tätigkeit auf eine ihm in den Sinnen gegebene Mannigfaltigkeit angewiesen ist, muss er diese Mannigfaltigkeit so zusammenfassen können, dass sie als etwas erfasst werden kann, über das sich Urteile bilden lassen.

Wir können nun Kants Argumentation genauer skizzieren. Die Sinnlichkeit als «Vermögen (Rezeptivität), Vorstellungen zu empfangen», ist ein passives Vermögen. Die Mannigfaltigkeit, die sie enthält, ist aufgrund dieser Passivität unzusammenhängend. Was wir in der Sinnlichkeit unterscheiden können, ist in ihr verschieden und getrennt; jeder Eindruck ist nichts als «absolute Einheit» (KrV A 99). Damit aus diesem Material Erkenntnis werden kann, muss es zunächst durchlaufen und zusammengefasst werden und dann begriffen werden.
Würden wir dabei den ersten Eindruck aus den Augen verlieren, während wir den zweiten wahrnehmen, wäre der zweite der erste und einzige Eindruck, und es könnte keine Einheit entstehen. Wenn wir also den zweiten Eindruck wahrnehmen, muss der erste als ein Eindruck reproduziert werden, der wahrgenommen wurde, aber nicht mehr ist. Dieser zweite Akt ist ebenso für jede Vorstellung räumlicher Ausdehnung und zeitlicher Dauer erforderlich wie für die Vorstellung einer darin enthaltenen Mannigfaltigkeit.
Damit dieses Mannigfaltige zur Vorstellung von etwas Bestimmtem wird, ist aber noch mehr erforderlich. Was erfasst und wiedergegeben wird, darf nicht mit allem und jedem verbunden werden, was in einer gegebenen Anschauung enthalten ist und durchlaufen wurde, sondern nur mit dem, was zu ihr gehört, d. h., was in ihren Begriff aufgenommen werden kann. Zu diesem Zweck muss es auch mit anderen Vorstellungen verglichen werden, die nicht in der gegebenen Anschauung enthalten sind. Denn ein Begriff ist eine Regel, die bestimmte zusammengehörende Repräsentationen vereint, während sie gleichzeitig diejenigen ausschließt, die nicht dazugehören. Die sinnlichen Daten, die ich aufnehme und unter dem Begriff ‹Hund› subsumiere, umfassen beispielsweise nicht die Matte, auf der er gerade schläft; aber sie müssen auch vergangene und mögliche zukünftige Wahrnehmungen eines wachen, herumlaufenden, fressenden Hundes usw. umfassen. Das wiederum ist nur möglich, wenn die verschiedenen Vorstellungen alle im selben Bewusstsein vorkommen. So wie verschiedene Wörter im selben Bewusstsein vorkommen müssen, um einen Satz zu bilden, müssen verschiedene Vorstellungen im selben Bewusstsein vorkommen, um einen Gedanken (Begriff) zu bilden: «Es ist also die Identität des Bewußtseins meiner selbst in verschiedenen Zeiten […] eine formale Bedingung meiner Gedanken und ihres Zusammenhanges» (KrV, A 363).
Doch wie genau ist diese Identität des Bewusstseins meiner selbst zu verstehen? Zunächst einmal bezeichnet sie nicht die empirische Person, die ich bin und die sich im Laufe der Zeit verändert und entwickelt, sondern das denkende Subjekt, von dem ich weiß: Alles, was ich in der Vergangenheit jemals gedacht habe oder in der Zukunft denken werde, sind Gedanken desselben Subjekts: meiner selbst. Ich habe also ein apriorisches Wissen von meiner Identität in allen meinen Bewusstseinszuständen, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft. Kant schreibt dazu: «Wir sind uns a priori der durchgängigen Identität unserer selbst in Bezug auf alle Vorstellungen, die zu unserem Erkenntnis jemals gehören können, als einer notwendigen Bedingung der Möglichkeit aller Vorstellungen bewusst (weil diese in mir doch nur dadurch etwas vorstellen, daß sie mit allen anderen zu einem Bewußtsein gehören, mithin darin wenigstens müssen verknüpft werden können). Dieses Prinzip steht a priori fest […].» (KrV, A 116)
Wir müssen also fragen: Wie ist ein solches apriorisches Wissen von der eigenen Identität durch die Zeit möglich? Wie kann ich jetzt schon wissen, dass ich auch in Zukunft alle Gedanken zur Einheit meines Bewusstseins verbinden und von einem Gedanken zu einem beliebigen anderen übergehen kann? Eine solche Erkenntnis ist nur möglich, so Kant, wenn die «Formen des Übergangs von einem Gedanken zum anderen» selbst a priori, d. h. konstant und unabhängig vom Inhalt der Gedanken sind.
Der Apriori-Charakter dieses Wissens wird deutlicher, wenn man es mit dem empirischen Wissen, das ich von meiner eigenen Biografie habe, vergleicht.4 Letztere, so viel weiß ich jetzt schon, setzt sich aus einer kontinuierlichen Folge von Episoden und Erfahrungen zusammen, die mich als die Person bestimmen, die ich bin. Aber was ich im Laufe meines Lebens erleben werde, kann ich nicht im Voraus oder a priori wissen. Ich muss abwarten und sehen, was das Leben für mich bereithält. Außerdem schließt jede neue Episode im Laufe meines Lebens andere aus, die bis zu diesem Zeitpunkt möglich waren, nun aber unwiederbringlich vergangen sind. ‹Es gibt keinen Weg zurück›, weiß selbst der Volksmund. Was dagegen die Gedanken betrifft, die ich in der Zukunft haben kann, so weiß ich, dass ich im Prinzip von jeder Vorstellung zu jeder anderen Vorstellung übergehen und eine beliebige Anzahl von Gedanken in Gang setzen kann. Solches Wissen ist jedoch nur möglich, wenn die Regeln, nach denen die Vorstellungen zueinander in Beziehung gesetzt werden, in der Zukunft die gleichen sind wie jetzt. Es müssen unveränderliche Regeln sein und damit unabhängig von empirischen Bedingungen: «Denn das Gemüt könnte sich unmöglich die Identität seiner selbst in der Mannigfaltigkeit seiner Vorstellungen und zwar a priori denken, wenn es nicht die Identität seiner Handlung vor Augen hätte, die alle Synthese der Apprehension (die empirisch ist) einer transzendentalen Einheit unterwirft, und ihren Zusammenhang nach Regeln a priori zuerst möglich macht.» (KrV, A 108)
Wenn wir fragen, was diese ‹identischen Handlungen› sind, welche die Vorstellungen in bestimmter Weise verbinden und die Einheit des Bewusstseins ermöglichen, so ist klar, dass es sich um nichts anderes handeln kann als um die Formen des Urteils. Die Einheit meines Bewusstseins, die ich mit dem Pronomen ‹ich› bezeichne, kommt dadurch zustande, dass ich Begriffe bilde und diese in Urteilen verwende. Die Formen der Urteile sind unveränderlich, und was in allen grundlegenden Akten des Urteilens identisch ist, ist der Bezug durch die in ihnen verwendeten Vorstellungen auf etwas von mir Verschiedenes, in dem diese Vorstellungen vereinigt sind: Ein Urteil, so definiert Kant einmal, ist «eine Handlung, durch die gegebene Vorstellungen zuerst Erkenntnisse eines Objects werden».5 Folglich ist die Erkenntnis, dass es Dinge außerhalb von mir gibt, ebenso gewiss wie das ‹Ich denke›, wobei jedes eine Bedingung für die Möglichkeit des anderen ist.
Dieses Argument – Kants ‹Transzendentale Deduktion der Kategorien› – wird weithin als eines der tiefgründigsten Argumente in der Geschichte der Philosophie angesehen. Es soll beweisen, dass alle Gegenstände der Erfahrung notwendigerweise den Kategorien unterworfen sind, weil keine Gegenstände ohne sie gedacht werden können. Dies geschieht dadurch, dass gezeigt wird, dass die Identität des Selbstbewusstseins, von der wir a priori wissen, ohne ein Wissen von Objekten unmöglich wäre. Selbstbewusstsein und das Bewusstsein von Objekten außer mir sind somit zwei Seiten derselben Medaille.
«Die Ordnung und Regelmäßigkeit also an den Erscheinungen, die wir Natur nennen, bringen wir selbst hinein, und würden sie auch nicht darin finden können, hätten wir sie nicht, oder die Natur unseres Gemüts ursprünglich hineingelegt.» (KrV, A 125) Folglich kann Kant beispielsweise mit David Hume darin übereinstimmen, dass unser Wissen über kausale Beziehungen zwischen Objekten und Ereignissen empirisch ist, während er gleichzeitig darauf besteht, dass es keine Ereignisse gäbe, die wir erfahren könnten, wenn wir nicht zuvor eine Vielzahl von Vorstellungen entsprechend der Kategorie der Ursache und Wirkung synthetisiert hätten. Denn wir könnten niemals die objektive zeitliche Ordnung eines Ereignisses von der bloß subjektiven Folge der Vorstellungen in uns unterscheiden, argumentiert Kant, es sei denn, wir hielten die Ordnung der Vorstellungen, die das Geschehen ausmachen, für unumkehrbar. Und das können wir nur, wenn wir denken, dass sie kausal strukturiert ist, weil eine Wirkung ihrer eigenen Ursache nicht vorangehen kann: «Es geht aber hiermit so, wie mit anderen reinen Vorstellungen a priori (z. B. Raum und Zeit), die wir darum allein aus der Erfahrung als klare Begriffe herausziehen können, weil wir sie in die Erfahrung gelegt hatten, und diese daher durch jene allererst zustande brachten.» (KrV A 196)
Die Illusionen der reinen Vernunft
Kant verglich seine ‹Kritik der reinen Vernunft› gern mit einem «Tribunal», das die Streitigkeiten der reinen Vernunft (Philosophie) ein für alle Mal beilegt, indem es die Wurzel ihrer Konflikte angreift. So bringt es die Skeptiker zum Schweigen, die bezweifeln oder leugnen, dass es apriorische Erkenntnis gibt. Eine solche Erkenntnis ist möglich, argumentiert Kant, aber nur in Bezug auf mögliche Erfahrungen. Nicht weniger wichtig ist jedoch, dass Kant auch alle dogmatischen Metaphysiker zum Schweigen bringen will, die meinen, sie könnten philosophisches Wissen jenseits möglicher Erfahrung beanspruchen. Anders als z. B. Descartes, der in seinen ‹Meditationen› die Hypothese eines ‹genius malignus› erwogen hatte, um die Möglichkeit einer generellen Täuschung zu demonstrieren, glaubt Kant zeigen zu können, dass die menschliche Vernunft aufgrund ihrer eigenen Natur unweigerlich auf Widersprüche stößt, sobald sie die Grenzen möglicher Erfahrung überschreitet. Verwirrt durch die Tatsache, dass gegensätzliche philosophische Positionen mit scheinbar gleich starken Argumenten begründet wurden, hatte Kant am Anfang seiner Karriere versucht, ganz systematisch metaphysische Sätze und ihre Gegensätze zu beweisen. Zu seiner Überraschung stellte er fest, dass ihm dies über alles Erwarten gut gelang.

Dies ist die dritte grundlegende Entdeckung, die Kant in seiner sogenannten vorkritischen Periode machte. Zeitlebens betrachtete er diese Erkenntnis als eine seiner bedeutendsten Einsichten: «[D]ie Antinomie der reinen Vernunft, die in ihrer Dialektik offenbar wird, [ist] in der That die wohltätigste Verirrung, in die die menschliche Vernunft je hat gerathen können, indem sie uns zuletzt antreibt, den Schlüssel zu suchen, aus diesem Labyrinthe herauszukommen».6 Dieser Schlüssel ist kein anderer als Kants transzendentaler Idealismus mit den damit verbundenen Behauptungen von der Idealität des Raumes (und der Zeit) und der grundlegenden Unterscheidung zwischen Erscheinungen und Dingen an sich. Der ostensive Selbstwiderspruch der Vernunft in den Antinomien kann also, so insistiert Kant, als ein indirekter Beweis des transzendentalen Idealismus gesehen werden. Denn wenn Raum und Zeit mit den darin befindlichen Gegenständen als Dinge an sich betrachtet werden, entstehen die Antinomien, und zwar zwangsläufig.
In der ‹Kritik der reinen Vernunft› stellt Kant das Problem wie folgt dar: Wenn die Vernunft das Reich der Erfahrung verlässt und sich auf das bezieht, was unabhängig von der menschlichen Erkenntnis existieren soll, so ist es z. B. ebenso möglich zu beweisen, dass die Welt einen Anfang in der Zeit hat und auch räumlich begrenzt ist, wie es möglich ist, ihre Negation zu beweisen: dass die Welt sowohl zeitlich als auch räumlich unendlich ist (KrV, A 426). In gleicher Weise könne man beweisen, dass jede zusammengesetzte Substanz aus einfachen, unteilbaren Teilen bestehe, als auch, dass sie unendlich teilbar sei (KrV, A 434). Man kann beweisen, dass alles in der Welt nach Naturgesetzen abläuft, und auch, dass es eine andere Kausalität gibt, nämlich die der Freiheit (KrV, A 445). Schließlich kann man beweisen, dass zur Welt ein absolut notwendiges Wesen (i. e. Gott) gehört, und dass zur Welt kein absolut notwendiges Wesen gehört (KrV, A 453).
In der ‹Kritik› verknüpft Kant diese Sätze nicht mit bestimmten Philosophen, aber es ist klar, dass sich für jeden von ihnen leicht historische Bezüge herstellen lassen. Jeder dieser antinomischen Sätze ist in der Vergangenheit von dem einen oder anderen Philosophen vertreten worden und hat in der traditionellen Metaphysik eine wichtige Rolle gespielt. Wenn dem so ist, kann man verstehen, warum es keine allgemeine Übereinstimmung unter den großen Denkern und keinen Fortschritt in der Geschichte der Philosophie gab. Sobald die theoretische Vernunft den Bereich mögliche Erfahrung verlässt, kann sie auch widersprüchliche Sätze ‹beweisen›, die für die Vernunft selbst zentral sind. Dies zeigt, so Kant, das Scheitern aller früheren Metaphysik. Denn eine solche Metaphysik konnte, da sie nicht in der Idealität von Raum und Zeit begründet war, nur einen der antinomischen Sätze dogmatisch behaupten, ohne dessen kontradiktorisches Gegenteil prinzipiell widerlegen zu können. Eine solche Philosophie ist also nicht fähig, Wahrheiten zu begründen und kann niemals den Status einer Wissenschaft erlangen. Kant zufolge kann nur der transzendentale Idealismus, wie er in der ‹Kritik der reinen Vernunft› vorgelegt ist, eine wissenschaftliche Metaphysik ermöglichen: «Allein der kritische Weg ist noch offen» (KrV, A 856).
Schluss

Dem letzten Satz, wonach der kritische Weg dem Wahrheitsforscher allein noch offen sei, braucht man, selbst bei größter Bewunderung von Kants Scharfsinn, nicht unumwunden zuzustimmen. Den Leserinnen und Lesern wird wahrscheinlich nicht entgangen sein, dass Kant bei seinen Überlegungen unausgesprochen voraussetzt, dass der menschliche Verstand nur diskursiv verfahren kann und sich alles Denken in der Verbindung von Begriffen in Urteilen abspielen muss, sofern es wahrheitsfähig sein will. Dem widersprach bereits Goethe, der 1790 in seinem ‹Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären› eine andere Erkenntnismöglichkeit darstellte, die er selbst «anschauende Urteilskraft» nannte und die man auch als intuitiven Verstand bezeichnen kann. Und auch Kants Charakterisierung der Vernunft ist nicht alternativlos. Ihm bewies das Auftreten der Antinomien, dass die Vernunft, sobald sie über Sinnliches hinausgeht, sich in Widersprüche verwickelt. Daraus zog er den Schluss, dass Übersinnliches nicht erkannt werden kann. Genauso kann aber daraus auch der Schluss gezogen werden, dass ein nicht-diskursives Denken erforderlich ist, um die übersinnliche Wirklichkeit zu erkennen.
Worauf es also ankommt, will man zwischen beiden Auffassungen eine begründete Entscheidung treffen, ist, die Methodologie und Charakteristik eines nicht-diskursiven Denkens mit einer Klarheit und Durchsichtigkeit darzustellen, wie Kant es uns für das diskursive Denken vorgemacht hat. Sein 300. Geburtstag kann deshalb auch Anlass zur Dankbarkeit dafür sein, gezeigt zu haben, auf welch hohem philosophischen Niveau wir uns bewegen müssen, wenn aus Meinung Wissen und aus Kenntnis Erkenntnis werden soll.
Titelbild Immanuel Kant. Punktgravur von F. W. Bollinger.
Fußnoten
- I. Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes (1763). In Kants Werke, Akademie-Textausgabe (im Folgenden: Ak.), Berlin 1968, Band 2, S. 74.
- Ich zitiere Kants ‹Kritik der reinen Vernunft› im Text nach der Originalausgabe (A) von 1781, die auch in allen modernen Ausgaben verzeichnet ist.
- I. Kant, Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raume (1768), Ak. 2, S. 381.
- Vgl. Dieter Henrich, Identität und Objektivität. Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Heidelberg 1976.
- I. Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (1786). In Ak. 4, S. 475.
- I. Kant, Kritik der praktischen Vernunft (1788), Ak. 5, S. 107.